Wolfgang Kapp und Walther von Lüttwitz putschen am 13. März 1920 in Berlin gegen die Regierung Bauer (SPD, Zentrum, DDP). Naumburg (Saale) durchlebt aufregende Tage. Die Bürgerschaft spaltet sich in Umstürzler (Georg Schiele*), Unterstützer (Max Jüttner*), Imponderabilisten (Arthur Dietrich*), Legalisten (Arthur Graf von Posadowsky-Wehner*), Versöhnler (Ernst Heinrich Bethge*) und Kapp-Gegner (August Winkler, Otto Teichmann, Otto Grunert, Leopold Heinrich, Paul Heese, Walter Fieker). Gegen eine spontane Unmutsbekundung der Bürger am 16. März auf dem Markt setzt die Reichswehr Schusswaffen ein. Daraufhin organisieren die Kapp-Gegner Waffen. Am 19. März kämpfen sie in der Michaelisstrasse, beim Evangelischen Lehrerseminar Naumburg, im Gebiet Moritzwiesen-Oberlandesgericht-Domplatz und beim Gasthaus Zur Tanne (Bad Kösen) gegen die Reichs- und Einwohnerwehr. Tote und Verwundete sind zu betrauern. Der Putsch stösst im Land auf breiten Widerstand und scheitert. Seine Protagonisten entziehen sich meist der Verantwortung.
SPD-Mitglied August Huth aus Bad Kösen, Saalberg 7, beklagt am 17. April 1920 im Brief an die Volksstimme (Halle):
"... denn ich glaube, es steht in der Weltgeschichte einzig dar, daß Männer, die für eine Regierung gekämpft und geblutet haben, und dadurch die Regierung gestützt und wieder in den Sattel gehoben, zum Dank dafür im Gefängnis sitzen dürfen und noch obendrein verprügelt werden. Wer soll nun vor einer Regierung Respekt haben, die ihre Anhänger, die für sie gestritten haben, in Stich läßt."
Widerstand
gegen den Kapp-Lüttwitz-Putsch
in Naumburg (Saale)
Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) und Deutsche Volkspartei (DVP) legen am 9. März 1920 zur 152. Sitzung der Nationalversammlung einen Antrag zum Wahlgesetz vor. Sie wollen deren Auflösung zum 1. Mai 1920 und geraten darüber natürlich in Streit mit den Regierungsparteien.
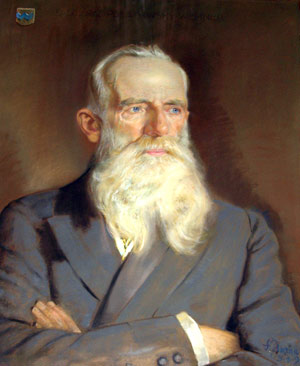 |
|
Arthur Graf
von Nach einem
Porträt von |
"Das Volk", beurteilt der Sprecher der DNVP-Fraktion Arthur Graf von Posadowsky-Wehner (Naumburg) [1, 2, 3, 4, 5] die nationale Lage,
"will endlich in gesetzlicher Form sein Urteil abgeben über die Arbeitsleistung der Nationalversammlung."
Mit Verabschiedung der Weimarer Verfassung und entsprechender Durchführungsgesetze, argumentiert er, ist das Mandat der gesetzgebenden Nationalversammlung und des Reichspräsidenten erloschen. Insoweit sind jetzt verfassungswidrige Zustände eingetreten, die es zu beseitigen gilt. "Wir streben dahin, dass im gesetzlichen Wege eine Regierung gebildet wird, in welcher die bürgerlichen Parteien den maßgebenden Einfluss besitzen." An der Erschütterung ihrer Macht zeigt die parlamentarische Mehrheit kein Interesse, weshalb sie den Antrag ablehnt. "Die Mehrheitsparteien gingen in ihren Ausfällen gegen die sachlich durchaus gerechtfertigten Wünsche der Opposition von rechts", schreibt Gustav Stresemann in Deutsche Stimmen (1920), "über alles Mass und Ziel hinaus."
Für den Konservativen Posadowsky-Wehner, kein Grund einen Putsch anzuzetteln. "Vor wenigen Tagen", heisst es im Aufruf des Reichspräsidenten und Reichswehrministers vom 14. März an die Reichswehr, "haben die Sprecher der Rechtsparteien in der Nationalversammlung, Graf Posadowsky und Doktor [Rudolf] Heinze übereinstimmend erklärt, dass der Versuch einer gewaltsamen Beseitigung der Republik ein verbrecherischer Wahnsinn sei." (Brammer 1920, 13)
Aber Mitglieder der ehemaligen Vaterlandspartei, Alldeutsche, Baltikum-Kämpfer, Deutschnationale (DNVP) und ultrarechts politisierte Offiziere, die schon seit Sommer 1919 mit der Militärdiktatur liebäugeln, schreiten zur Tat. Sie hassen die Marxisten (Sozialdemokraten) und alle Novemberverbrecher, suchen die innenpolitische Revanche für den Versailler Vertrag, den die Regierung Bauer (SPD, Zentrum, DDP) am 10. Januar 1920 in Kraft setzte.
Die "Dreistigkeit der reaktionären Offiziere und Beamten" nimmt zu, worauf 1935 Philipp Scheidemann (2002, 139) im Zusammenhang mit den Fehlern Eberts hinwies. Oberst Reinhard beschimpfte auf einem Berliner Kasernenhof die Reichsregierung als "Lumpengesindel".
Dass 1919 von den Alliierten gestellte Auslieferungsbegehren gegenüber Deutschen, die sich gemäss Artikel 228 bis 230 des Versailler Vertrags Kriegsverbrechen schuldig gemacht hatten, sorgte unter den höheren Offizieren für miese Stimmung. Reichsaussenminister Hermann Müller (SPD) teilte am 20. Januar 1920 Reichskanzler Gustav Bauer (SPD) mit, dass er an der Auslieferung nicht mitwirken wird. Der Vorsitzende der deutschen Friedensdelegation Kurt Freiherr von Lersner (Deutsche Volkspartei) verweigerte am 3. Februar 1920 die Annahme der alliierten Auslieferungsliste mit 895 Namen. "Das deutsche Auswärtige Amt hat umfangreiche Aktenstücke gesammelt," teilt das Naumburger Tageblatt am 13. Februar 1920 mit, "welche den einwandfreien Nachweis liefern, die dass gegen uns mit offenkundigen Lügen und Meineid und Fälschung, mit Verdrehung und böswilliger Entstellung gearbeitet worden ist, um die Haßstimmung der ganzen Welt gegen uns aufzupeitschen."
Ansehen und Wohlstand der Garnisonsstadt Naumburg beruhten wesentlich auf der Kasernenwirtschaft. So traf sie die Forderung des Versailler Vertrages hart, die Reichswehr auf 100 000 Mann zu reduzieren. Im März 1920 stand die Schliessung der Kasernen bevor, was die Massenentlassung von Berufssoldaten und Offizieren bedeutete. Kapp und Lüttwitz verstanden es die Unzufriedenheit der Offiziere und Berufssoldaten auszunutzen.
Wochen und Monate vor dem 13. März erhielt die Regierung aus verschiedenen Quellen Hinweise, dass gewisse politische und militärische Kreise den Umsturz planen. Der "völlig unfähige Noske" (Tucholsky 1920) reagiert unzureichend.
Indessen wächst der Wille zur Tat (Max Jüttner). Die 6 000 Mann zählende Marinebrigade Ehrhardt steht der militanten Rechten zur Reserve. Reichswehrminister Noske ordnete am 29. Februar ihre Auflösung an. "Ich werde nicht dulden, dass mir eine solche Kerntruppe in so gewitterschwüler Zeit zerschlagen wird" , reagierte darauf am 1. März aus Anlass einer Parade im Döberitzer Lager der Reichswehr-Oberbefehlshaber von Berlin General Walther von Lüttwitz (Oertzen 364). Noske entzieht ihm das Kommando über die Einheit.
Der Umsturzversuch am 13. März kam nicht überraschend. General Walther von Lüttwitz überbrachte zusammen mit Erich Freiherr von Oldershausen und von Oven dem Reichspräsidenten bereits am 9. März die Forderungen der Putschführer. "Anstatt die dreisten Feinde der Republik durch die Dienerschaft hinauswerfen und dann ohne viel Federlesen verhaften zu lassen," empört sich 1935 Philipp Scheidemann (142), "lud der sozialdemokratische Präsident der Republik die Herren freundlichst zum Platz nehmen ein, liess den Reichswehrminister kommen und fing nun an mit den Rebellen zu verhandeln." Lüttwitz`s Forderungen lauteten: Widerstad gegen die geforderte Verringerung der Reichswehr und Waffenabgabe an die Entente, Entlassung sozialdemokratischer Minister und Neuwahl der Nationalversammlung. Zunächst liess die Regierung die Bürger darüber im unklaren, obwohl die Nationalversammlung noch bis 12. März mittag zusammen war.
Lüttwitz will ausserdem den Chef der Heeresleitung General Reinhardt entlassen und die Änderung der Unterstellung der Marine-Brigade-Ehrhardt rückgängig machen, worüber es zum heftigen Zusammenstoß mit Noske kommt.
Angesichts der Insubordination von Lüttwitz, sah sich Noske gezwungen ihn am nächsten Tag seines Postens zu entheben. Der setzte daraufhin, um die rechtmäßige Regierung zu verhaften und Kapp ins Amt zu verhelfen, in der Nacht vom 12. zum 13. März die Marine-Brigade Ehrhardt in Bewegung. Etwa zeitgleich, so beschreibt 1920 Karl Brammer in Fünf Tage Militärdiktatur (10) die Lageentwicklung, findet eine Kabinettssitzung statt. Den Kampf gegen die Marine-Brigade-Ehrhardt will die Regierung nicht aufnehmen, um sinnloses Blutvergiessen zu vermeiden.
Unterstützt von General Erich von Ludendorff, Oberst Max Bauer und Oberst Walter Pabst, beabsichtigt Wolfgang Kapp die Regierung verhaften zu lassen. In den frühen Morgenstunden des 13. März flüchten der Reichspräsident, der Reichskanzler und der Reichswehrminister im Kraftwagen nach Dresden. Der Stellvertreter des Reichskanzlers Schiffer verharrt mit Unterstaatssekretär Albert in der Reichskanzlei. Die übrigen Mitglieder der Reichsregierung folgen mit der Eisenbahn. Jetzt können die legitimen Führer der Republik Massnahmen zur Abwehr der Gegenrevolution ergreifen, was die Erfolgsaussichten der Putschisten schmälerte. Aber das ist umstritten. Für Heinrich Ströbel (1920, 353) demonstrierte die Regierung damit lediglich ihre Kopflosigkeit und Ohmacht.
In Dresden angekommen, tritt gegen 12 Uhr Generalmajor Georg Maercker (1865-1924) in Begleitung seines Stabes vor die Regierung und posamentiert ihnen auseinander, dass er als Soldat gehalten sei, den Befehl seines Vorgesetzten General Lüttwitz zu gehorchen und sie zu verhaften. Dies scheitert an der Unterstützung des sächsischen Staatsministeriums, das die Regierung Ebert-Bauer unterstützt.
Gegen 7 Uhr morgens tauchen am Sonnabend, den 13. März im Regierungsviertel von Berlin Lastwagen mit aufmontierten Maschinengewehren und wehender Reichskriegsflagge auf. Wolfgang Kapp, Freiherr von Falkenhausen und Traugott von Jagow treten um ¾ 7 Uhr vor das Gebäude des Reichskanzlers, wo sie auf den Unterstaatssekretär Albert treffen und ihm eröffnen, dass sie die Regierungsgewalt ergreifen werden. "Auf die Frage, mit welcher Legitimation dies geschehe, erwidert Herr v[on] Jagow:
Mit dem Recht des 9. November 1918.“ (Albert)
Der Kampf um die Macht nimmt burleske Formen an. "Wo ist Schnitzler? Ohne Schnitzler kann ich nicht regieren!", soll Kapp im Büro ausgerufen haben. Das lässt auf eine jämmerliche organisatorische Vorbereitung schliessen. Gegen den Schriftsteller, der für die Ausarbeitung des Aktionsprogramms verantwortlich war, wurde nebst Kapp, Hauptmann a. D. Pabst und Grabowski am 12. März, meldet am Tag darauf die Volksstimme (Magdeburg), Schutzhaft verhängt.
Generallandschaftsdirektor Kapp, Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank und Vorstandsmitglied der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), erklärt die Nationalversammlung und den Preußischen Landtag für aufgelöst, ernennt sich zum Reichskanzler und Walther Freiherr von Lüttwitz zum Reichswehrminister. Ihn trieben noch weitergehende Pläne um. In den Schubladen der Kappisten fanden Erwin Könnemann und Hans-Joachim Krusch (1981, 23f.) den Entwurf einer Notverfassung, der die Wiederinkraftsetzung der Reichsverfassung vom 14. April 1871 vorsah.
 |
|
Volksstimme.
Sozialdemokratisches Organ für den Regierungsbezirk Magdeburg,
Magdeburg, den 14. März 1920
|
Am selben Tag erscheint in vielen größeren Städten ein Aufruf zum Generalstreik, der von Friedrich Ebert, sozialdemokratischen Regierungsmitgliedern und dem Parteivorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Otto Wels unterzeichnet ist.
"Tatsächlich widersprach er allem", urteilt August Winkler (1998, 122) in der Geschichte der ersten deutschen Demokratie, "was man bisher von Ebert, Bauer und Noske gehört hatte. Eine Aufforderung zum Generalstreik bedeutete eine völlige Kehrtwendung der bis zum 13. März 1920 befolgten Politik".
"Als die Putschisten jedoch geschlagen waren und die SPD dominierte Regierung wieder die Oberhand mittels Generalstreik erlangt hatte," worauf Klaus Gietinger (223) die Aufmerksamkeit lenkt, "wollte diese von ihrem Aufruf dazu nichts wissen, im Gegenteil, sie witterte in der Volksbewegung gegen Kapp Bolschewismus."
"Lasse sich kein denkender Arbeiter, Angestellter und Beamter,"
warnt der ADGB (Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund) und der AFA (Allgemeiner freier Angestelltenbund) aus Anlass des Kapp-Putsches am 13. März aus Berlin,
"durch zweifelhafte Versprechungen der Putschregierung betören. Es gilt alle Kräfte des Volkes zum Widerstand zusammenzufassen."
"Ohne Kenntnis von dem Aufruf der Regierung haben die Gewerkschaften [ADGB] bereits am 13. März mittags 11 Uhr im Bundesvorstand den Generalstreik beschlossen", hebt Carl Legien am 30. März 1920 in der Nationalversammlung hervor. "Es folgte dann auch die Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände [AfA] und die sozialdemokratische Partei."
Der Aufruf zum Generalstreik findet in den Städten und Dörfern starken Widerhall. Zu den Zentren des Widerstandes in der mitteldeutschen Region gehören das Kraftwerk Zschornewitz, Bitterfeld-Delitzsch, Halle, Leipzig, Merseburg, Osterfeld, Zeitz, Weißenfels und Naumburg.
Am Nachmittag des 13. März beraten die Vorstände von ADGB, SPD, USPD und der KPD-Zentrale über gemeinsame Abwehrmaßnahmen zum Putsch.
Wolfgang Kapp bietet Georg Schiele aus Naumburg das Wirtschaftsministerium an. "Am 2. März [1920] ist Herr Kapp persönlich zu mir gekommen und hat mir mitgeteilt," gibt er im Jagow-Prozess zu Protokoll, "dass in der Nacht vom 12. zum 13. die Marinebrigade Ehrhardt auf Berlin marschieren würde .... Es könnte sein, dass im Anschluss hieran ein Wechsel der politischen Macht eintreten würde. Es könnte sein, dass er vom Militär die ausführende Gewalt übertragen bekommen würde. Und im Anschluss hieran richtet er die Anfrage an mich, ob ich
aufgrund unserer Freundschaft
ihm nach Aenderung der politischen Machtverhältnisse meine Mitwirkung nicht versagen würde. .... Ich habe ohne Zögern eine kurze Zusage erteilt ...." (Brammer 1922, 30)
Der ostpreussische Generallandschaftsdirektor wusste genau, um wen er da für sein Kabinett warb. 1916 widmete Georg Schiele "aus grosser Verehrung und Dankbarkeit" dem "genialen und willensstarken Vorkämpfer grosser Ideen...." die Schrift Wenn die Waffen ruhen!. Man kannte sich aus der Gründerzeit des Hugenberg-Konzerns. Etwas später führte sie die Tätigkeit in der Deutsche Vaterlandspartei (DVLP) zusammen.
Drei Wochen vor dem Putschversuch präsentierte der Naumburger im Aufsatz
Marktfreiheit und Freizügigkeit
die Normative seiner Wirtschaftspolitik. "Alles wird weiter zwangsbewirtschaftet", tadelt er an der Regierung und spricht abschätzig von ihr, weil sie quasi planwirtschaftlich die "sogenannte Sicherstellung der Ernährung in den Städten" organisiert. Das zerstört den freien Preis und die Marktfreiheit. Kein Wort darüber, dass sie den Schwarzmarkt für Grundnahrungsmittel bekämpft, um die einkommensschwachen Schichten vor Hunger und Elend zu schützen. Kapps Wirtschaftsminister würde sie ohne mit der Wimper zu zucken, der Freiheit des Warenverkehrs opfern. Nur der freie Markt lockt [im Februar 1920!] die "Nahrungsmittel" herein, "mit denen wir die Hungermonate" überwinden. Dann werden - versprach Doktor Georg Schiele -
die Gänse aus Polenland über die Grenze
marschieren und Erbsen und Linsen
durch die Luft fliegen. zurück
Zu den Ereignissen in Naumburg (Saale)
 |
13. März, Sonnabend zurück
Naumburg. Eine gewisse Erregung ist in der Stadt spürbar. Auf den Plätzen und Strassen bilden sich Gruppen. Hastig tauschen die Bürger Informationen über die Ereignisse in Berlin und Halle aus, die sie vor allem über die Institutionen der Parteien und Gewerkschaften erreichen. Zeitweise sind es die wichtigsten Quellen. Gerüchte jagen einander durch die Strassen. Überregionale Zeitungen erscheinen oder erreichen sie nicht mehr. Ein fragiler, mit kontradiktorischen Widersprüchen durchsetzter und opaker Informationsraum entsteht. Viele Bürger verhalten sich abwartend. Und keine Tätlichkeiten, keine Übergriffe auf das Privateigentum. zurück
Am 14. März warnt Otto Hörsing (SPD), Oberpräsident der Provinz Sachsen mit den Städten Stendal, Magdeburg, Dessau, Wittenberg, Torgau, Sondershausen, Mühlhausen, Halle, Merseburg, Weißenfels, Zeitz und Naumburg:
"Niemand lasse sich durch falsche Nachrichten beeinflussen, die geflissentlich von Berlin aus in die Welt gesetzt werden."
Dafür hatte er allen Grund. Der stellvertretende Kommandeur der Reichswehrbrigade XVI Generalmajor Hagenberg verbreitete am Tag zuvor die Nachricht, dass die bisherige Reichsregierung zurückgetreten ist.
Offiziell erhält als erstes die Gegenregierung in der gegen 11 Uhr vormittags erscheinenden Sonderausgabe des Naumburger Tageblatt das Wort und teilt mit:
"Die bisherige Regierung hat aufgehört zu sein."
"Eine neue Regierung der Freiheit, und der Tat wird gebildet."
Der Reichskanzler und Preussische Ministerpräsident Wolfgang Kapp (!) spricht der Nationalversammlung "jedes Recht zur weiteren Tagung" ab.
"Die sozialistischen Parteien Deutschlands proklamieren den Generalstreik."
Die bedeutet eine informationspolitische Unterstützung der Putsch-Regierung durch die Stadtzeitung. Eine Losung wie
Aufbau und Arbeit, statt Umsturz!
kommt der Redaktion nicht in den Sinn. Zehn Tage später teilt sie über
Die Vorgänge in Naumburg seit der Gegenrevolution
mit, dass die Zeitung nicht erscheinen konnte, weil die Arbeiter von der Setzerei und Druckerei in Streik getreten waren. Der Aktionsausschuss nennt im Mitteilungsblatt vom 18. März den wahren Grund:
"Die niederträchtige Verhetzung des Bürgertums durch das Naumburger Tageblatt und die damit in gewissenlosester Weise betriebene Verleumdung und Herabsetzung der Arbeiter".
|
|
In den Stunden der Ungewissheit übernimmt Leopold Heinrich von der USPD die Initiative. "Es war an einem Sonnabend [13. März], und der Abend hatte sich etwas ausgedehnt", erinnert er sich. "Morgens wurde ich von meiner Frau geweckt und sie brachte mir die Nachricht, dass die Regierung gestürzt sei und zum Generalstreik aufgerufen wurde. Da war ich schnell aus den Federn. Ich habe die Funktionäre von der USPD und vom Gewerkschaftskartell verständigt. Wir haben uns dann in meiner Wohnung [Dompredigergasse 16] besprochen und haben beschlossen, mit der SPD Verbindung aufzunehmen. Ich ging zum Genossen August Winkler (SPD) [Schönburger Straße 27] und habe ihn eine Besprechung vorgeschlagen. Er war damit einverstanden. Wir legten den Zeitpunkt fest, zu dem im Goldenen Hahn eine Sitzung stattfinden sollte. Hier wurde der Aktionsausschuss gebildet, und ich wurde 1. Vorsitzender." (Wsf 16) (Während der Beratung im Goldenen Hahn unterbreiten die Teilnehmer wahrscheinlich lediglich die Personalvorschläge für den Aktionsausschuss. Gewählt wurde er am nächsten Tag in der Reichskrone.)
Merseburg. Die Bezirksleitung der Sozialdemokratischen Partei, der Unabhängigen Sozialdemokraten und der Kommunistischen Partei warnen:
"Nur eine geschlossene Phalanx des gesamten arbeitenden Volkes kann die Diktatur der deutschnationalen Monarchisten verhindern."
Zeitz, Weißenfels, Hohenmölsen, Teuchern und Naumburg. Rührige USPD- und SPD-Mitglieder mobilisieren zum Widerstand gegen Kapp-Lüttwitz. Ortsgruppen organisieren die Tätigkeit der Aktionsausschüsse. KPD-Mitglieder beteiligen sich aktiv. Die meisten Akteure des Widerstandes gehören keiner Partei an.
Weimar, Sitz der Regierung vom Freistaat Sachsen-Weimar-Eisenach. Gespannt verfolgen die Naumburger Kapp-Gegner das Verhalten der Reichswehr gegenüber der demokratisch gewählten Regierung und dem Aktionsausschuss.
Der stellvertretende Kommandeur der Reichswehrbrigade 16 und militärische Befehlshaber des Regierungsbezirks Merseburg (zu dem Naumburg gehört) und von Ost-Thüringen Generalmajor von Hagenberg kündigt an, gegen alle Formen der Unruhe und Streiks "rücksichtslos ein[zu]schreiten". Er sichert mit seinen Truppen den Marstall und das Schloss.
Um den politischen und militärischen Widerstand gegen Kapp zu organisieren, formierte sich frühzeitig ein von Delegierten der SPD, KPD, USPD und Gewerkschaften gewählter Aktionsausschuss. Er beschloss die Bewaffnung der Arbeiter, rief den Generalstreik aus und forderte die Regierung auf, die Sicherheitspolizei (Sipo) zu entwaffnen. Die Arbeiter stürmten das von der Sipo bewachte Waffenmagazin im Regierungsgebäude, heute Hochschule für Musik Franz List. Dann verteilten sie an die Kämpfer des Aktionsausschusses über zweitausend Gewehre, mehrere Maschinengewehre, viel Munition und Handgranaten. Einen anderen Teil deponierten sie im Volkshaus. (Vgl. Pfotenhauer 13)
"Das unerwartet schnelle und entschlossene Auftreten der Weimarer Arbeiter hatte die Putschisten veranlasst,
militärische Hilfe aus Naumburg
anzufordern. Die Kundschafter der Roten Hundertschaften hatten festgestellt, dass in den
späten Abendstunden des 13. März
eine größere Abteilung Naumburger Jäger
in Anmarsch war. Wie sich dann zeigte, hatten die Naumburger den Auftrag, die Regierungsgebäude zu besetzen und den Rücktritt der verfassungsmäßigen Regierung zu erzwingen." (Pfotenhauer 13/14)
Die
Jäger besetzten das Stadtgebiet
zwischen dem Platz der Demokratie und Schloss, wo bereits einige Abteilung der Hundertschaft einer Arbeiterwehr in Stellung gegangen waren. Allerdings gab der Abschnitts-Kommandeur, "ein unentschlossener USPD-Genosse", nicht den Befehl zum Schießen, obwohl es laut Otto Pfotenhauer (1973, 14) ein leichtes gewesen wäre, die in dichten Linien vom Schloss heranrückenden Jäger - "zumal die Lampen in der Nähe des Schlosses gute Sicht gaben" - unter Feuer zu nehmen und in die Flucht zu schlagen.
"Im Schutze der Nacht hatte eine
zweite Abteilung der Naumburger
von der Parkseite her, aus Richtung des heutigen Hauses der Jungen Pioniere, den Angriff begonnen. In letzter Minute, die Angreifer schon im Rücken, mussten Junggenossen ihre Stellung aufgegeben und dabei auch einen Teil der Waffen in Stich lassen."
Reichswehr und Einwohnerwehr zurück
Vielerorts steht die Reichswehr auf der Seite von Kapp-Lüttwitz. Es war die "Treulosigkeit adliger Offiziere", erkannte die Volksstimme (Magdeburg) am 21. März 1920, die sich auf ihr Ehrenwort sonst unendlich viel zugutetaten, den es zu verdanken war, dass es im "Kampf um die Republik" den Putschisten gelungen war, die Regierungsgebäude zu besetzen.
In Königsberg stehen die Kommandeure der Reichswehrbrigade 1 Generalleutnant Ludwig von Estorff und Wilhelm Canaris zu den Putschisten. Vizeadmiral Adolf von Trotha stellt die Marine zur Verfügung. Paul Lettow-Vorbeck, Kommandeur der Reichswehrbrigade 9 (Mecklenburg-Schwerin), unterstellt sich der Rebellenregierung. Der Kommandeur der Reichswehrbrigade 3 General Hülsen setzt seine Truppen in Richtung Berlin in Marsch. Passiv verhält sich der Stab der Reichswehrbrigade 4 unter Generalmajor Wilhelm Groddeck in Magdeburg. In der Provinz Sachsen (mit den Städten Stendal, Magdeburg, Dessau, Wittenberg, Torgau, Sonderhausen, Mühlhausen, Halle, Merseburg, Weißenfels, Zeitz, Naumburg) ist keine Unterstützung der dislozierten Reichswehr für die Republik zu beobachten. In Halle (Saale) sympathisiert der Kommandeur des Infanterie-Regiments 31 Oberst Hermann Czettritz mit den Umstürzlern.
Für Naumburg ergibt sich folgendes Lagebild:
[A] Die Reichswehr flaggte erst am 27. Januar 1920, also zu Kaisers Geburtstag, in den Kasernen Schwarz-Weiss-Rot und hielt dazu eine Parade wie zu Wilhelms-Zeiten ab. Deshalb ahnen die Kapp-Gegner nichts Gutes und befürchten Verrat.
[B] "Am 13. März 1920 [dem Tag des Putsches] wurden an den Fenstern der neuen Jägerkaserne [in Naumburg] schwarz-weiss-rote Fahnen ausgehängt", berichtet Bernhard Düwell am 29. Juli 1920 dem Reichstag. " Es wurde Unteroffizieren und Mannschaften, die erklärten: wir stehen auf dem Boden der alten Regierung und machen für Kapp-Lüttwitz nicht mit -, bedeutet, dass sie nach Einhaltung der Kündigungsfrist sich als entlassen betrachten könnten. …. Diese Entlassungen sind tatsächlich vorgenommen worden." Weiter eröffnet der Reichstagsabgeordnete der Versammlung, dass in der Naumburger Garnison zwei Kompanien "zu kapistischen Soldaten erzogen" wurden. Ein Waffenmeister erhielt von einem Offizier den Auftrag: "Machen Sie Wandhaken zurecht, damit wir die Kaiserbilder wieder aufhängen können."
[C] Die USPD-Bezirksleitung (Halle) stellt am 7. April 1920 im abschliessenden Bericht zur Rolle der Reichswehr in Naumburg fest:
"In der reaktionären Beamtenstadt Naumburg fanden die Reichswehrtruppen die Unterstützung des Bürgertums, und die Arbeiter hatten dort einen schweren Stand." zurück
[D] Am 9. April 1920 resümiert der Oberpräsident der Provinz Sachsen Otto Hörsing: Militär und die Zeitfreiwilligenverbände nehmen in der Provinz Sachsen während des Kapp-Putsches zur Machtfrage zumindest eine unklare Haltung ein.
[E] Der Kommandeur des Reichswehr-Jäger-Regiments 32 mit 1/3 Nachrichten- und Radfahrer-Kompanie 32 Major Meyn (Naumburg) verhält sich illoyal, verfassungswidrig und hochverräterisch gegenüber der Regierung Bauer. Am Nachmittag des 13. März zieht er mit seiner Einheit nach Weimar, um die dortige Regierung zu verhaften. In einem Erlass für die Truppe bezeichnet er Doktor Kapp als "glühenden Patrioten" und "tatkräftigen Politiker".
"Das ist also die regierungstreue Haltung,"
donnerte Bernhard Düwell am 29. Juli 1920 im Reichstag,
"die der Kommandeur der Naumburger Garnison in den Märztagen d. J. eingenommen hat."
"Schon allein durch diese Tatsachen, die ich Ihnen hier vortragen konnte, durch die Wiedergabe einiger Stellen aus der Kundmachung, die der Ganisonskommandeur von Naumburg am 13. März gemacht hat, und durch die Aussagen eines Hauptmanns der Naumburger Garnison an den Regierungskommissar Krüger in Merseburg ist ja ganz klar und einwandfrei der Beweis geführt, dass die damalige Naumburger Garnison sich vollständig auf den Boden der Kapp und Lüttwitz gestellt hatte, dass sie also meineidig und hochverräterisch geworden war."
[F] Die Naumburger Jäger kämpften in Weimar. Für den Aktionsausschuss war dies der endgültige Beweis, dass die Reichswehr auf der Seite von Kapp-Lüttwitz stand.
[G] Georg
Maercker, seit Dezember 1918 Kommandeur des Freiwilligen Landesjägerkorps,
dann Reichswehrbrigade XVI, galt
bei den Arbeitern als monarchistisch eingestellter General. Die Kooperation
und Zusammenarbeit der Einwohnerwehren mit ihm löste bei vielen Kapp-Gegnern
politisches Unbehagen und Misstrauen aus.
Neben Reichswehr, Zeitfreiwilligenverbänden, Sipo und Arbeiterwehr (Aktionsausschuss), übernimmt die Einwohnerwehr während des Kapp-Putsches Aufgaben der inneren Sicherheit. zurück Ihr Aufbau und besonders die Personalrekrutierung verfolgt von Anfang an politische Ziele. Die darin angelegten Konflikte und Gegensätze brechen im März 1920 mit Macht hervor.
Vergeblich verlangte die USAPD kurz nach Aufstellung der Bürgerwehr am 7. März 1919 im Nachbarort Bad Kösen, dass die Hälfte Arbeiter sein sollen. (Vgl. Budde) Die sich aufbauenden Spannungen zwischen der USPD und dem Aktionsausschuss einerseits und der Einwohnerwehr (Kaufmann Siebold, Bäcker Seiffert, Eisenbahner Martin, Zimmermann Töpfer) andererseits, entladen sich in den Kämpfen in Bad Kösen am 19. März. (Siehe unten: Ereignisse am 19. März, Abschnitt Bad Kösen.)
Als während des Kapp-Putsches in Naumburg der Konflikt zwischen Einwohnwehr und Ausgeschlossenen zu eskalieren drohte, versuchte man sie am 14./15. März doch noch in die Einwohnerwehr aufzunehmen. Das scheiterte.
In Naumburg beauftragten die Stadt- und Kreisbehörden den ehemaligen Hauptmann im Generalstabe Max Jüttner mit der Schaffung einer Zentralbefehlsstelle der Einwohnerwehr. zurück Die rechtlichen Grundlagen hierfür legte das Reichswehrministerium mit dem Erlass der Verordnung zur Bildung der Einwohnerwehren vom 25. April 1919. Danach besteht ihre Aufgabe in der Herstellung und Wahrung von Ordnung und Sicherheit.
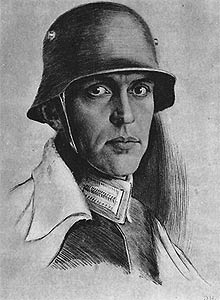 |
|
Max Jüttner
(1888-1963) |
Dem Kreisrat für die Einwohnerwehren Naumburg Stadt, Naumburg Land und Eckartsberga Max Jüttner unterstehen bald 10 000 Wehrmänner. (Vgl. Könnemann 160) Über ihre Möglichkeiten kommuniziert er im Brief an Wolfgang Kapp vom 24. Februar 1920:
"Hochzuverehrender Herr Geheimrat!
Euerer Hochwohlgeboren erlaube ich mir, zunächst einige Eindrücke zu übermitteln, die ich in den letzten Monaten gewonnen habe und die, meiner Meinung, beachtenswert sind."
Nach dem üblichen devoten Entrée, trägt er sein Anliegen vor:
Dann der Blitzbericht zum Stand Vorbereitung:
"1. Der Geist der Einwohnerwehren in den Kreisen Naumburg herum ist ganz vortrefflich. Der Wille zur Tat ist überall vorhanden. Die Tat richtet sich nach dem Willen der einzelnen Wehrführer, und diese wiederum sind ausgesuchte, vorzügliche Männer, die nur tun, was ich will. Das habe ich wiederholt praktisch erprobt, als es sich um parteipolitische Entscheidungen oder um die Stellungnahme zu militärischen Maßnahmen handelte. In jedem dieser Fälle wurde ich von den Führern nach meinem Willen gefragt."
Unter dem Code Wille zur Tat operiert der Kreisrat im Sinne der Gegenrevolution.
Offiziell sollen die Einwohnerwehren für Ruhe und Ordnung sorgen. Sie bewachen und schützen einige öffentliche Gebäude, was im allgemeinen Interesse lag. Während der Putsch-Tage eskamotiert sie zur Truppe der Gegenrevolution. Die ausgesuchten, vorzüglichen Männer der Einwohnerwehr tun nur das, was ihnen der Kreisrat befiehlt.
Vier Wochen nach der Niederschlagung des Putsches stellt SPD-Mitglied August Huth (Bad Kösen, Saalberg 7) im Brief an die Redaktion der Volksstimme in Halle erleichtert fest: "Darum ist es zu begrüssen, dass endlich Orts- und Sicherheitswehren von verfassungstreuen Sozialdemokraten gebildet werden." "Um eins bitte ich, liebe Genossen," schliesst er den Brief, "sorgen Sie dafür, dass in den drei Nestern Naumburg, Schulpforte und Bad Kösen die Wehren endlich auf dem schnellsten Wege gebildet, denn hier geht was vor, also aufgepasst." (Handelte es sich hierbei vielleicht um den "Mitteldeutschen Treuebund", der den Einsatz von Zeitfreiwilligenverbände zum Streifendienst plant?)
Im Brief von Max Jüttner an Wolfgang Kapp heisst es weiter:
"2. Es genügt ganz geringe Mühe, um die Verehrung für Exzellenz L. [Ludendorff] wieder zu wecken. Sie wurzelt im Allgemeinen fest. Meist hat es nur an Mut gefehlt, sie offen zu bekennen."
Können die Piraten der Republik (Ströbel 1920) den Massen einen Vorturner präsentieren, dann bestanden, so offenbar ihr Auffassung, für das Gelingen des Vorhabens gute Chancen. Sogleich die Offerte von Jüttner:
"3. Ich halte es für einfach, den Namen Euerer Hochwohlgeborenen populär zu machen, denn allenthalben begegnet man folgender Auffassung von der Lage: Deutschland braucht zu seiner Rettung einen Mann mit starkem Herzen, der über den Parteien steht, sich mit Fachmännern umgibt und rücksichtslos alle die unterdrückt, die gegen das Vaterland arbeiten, nur für ihre Partei regieren und ihre Person über die Sache stellen."
Die Pläne der verfassungsfeindlichen Rechten gründen mindestens auf zwei schwerwiegenden politischen Fehleinschätzungen:
Erstens. In der Vorstellung Ludendorff als Landesvater aufbauen zu können, kommt eine schwere Form der politischen Verirrung zum Ausdruck. Wohl sind einem Volk, das dem Hohenzoller nachtrauert, der sie in die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts geführt hat, durchaus noch weitere Gemeinheiten gegen sich selbst zuzutrauen. "Wenn es einen Menschen gibt, der angesichts der politischen und wirtschaftlichen Nöte unsrer Zeit zwingenden Anlass hat, recht still zu sein," empfiehlt die Volksstimme (Magdeburg) vom 26. Oktober 1919, "so ist es der General Ludendorff. Keiner trägt schwerer an der Verantwortung für die Katastrophe des deutschen Volkes als er."
Zweitens. Die verfassungsfeindliche Rechte verkennt, dass die Mehrheit der Lohn- und Gehaltsabhängigen an einem rechtsextremen Staatskurs zur Abschaffung des Achtstundentages, Aufhebung des Streikrechts und Absenkung der Arbeitsentgelte kein Interesse hat. In diesem Sinne warnt der Naumburger Aktionsausschuss am 18. März:
"Ihr wißt, was euch bevorsteht, wenn diese reaktionären Gewaltpolitiker in Deutschland zur Macht gelangen sollten. .... Abwälzung aller Kriegslasten auf die Schultern der breiten Masse, bei gesteigerter Ausbeutung weitere Herabsetzung der Lebenshaltung der werktätigen Bevölkerung."
14. März, Sonntag zurück
Weimar (Thüringen). Die Regierung August Baudert (SPD) scheint nicht mehr handlungsfähig zu sein. Ihre Geschäfte übernimmt Rechtsanwalt Jörck. Sofort wurden neue verschärfte Bestimmungen des Generals von Hagenberg über den Ausnahmezustand bekannt gegeben. Versammlungen von mehr als 20 Personen unter freien Himmel sind untersagt. Offiziere erhalten die Rechte von Polizeibeamten. Jede Niederlegung der Arbeit ist verboten. Wer mit Waffen angetroffen wird, läuft Gefahr erschossen zu werden. (Pfotenhauer 16)
Magdeburg. Otto Hörsing, Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, verurteilt den Putsch und ruft zur "Verteidigung der Rechte des Volkes" auf. Das war nicht so selbstverständlich, wie es uns heute erscheint, gab es doch zur Genüge Unzufriedenheit mit dem Kabinett Gustav Bauer. Dabei tat sich besonders der sozialdemokratische Oberpräsident von Ostpreußen August Winning (1955, 275), der erklärte: "Ich konnte ihren Sturz nicht bedauern, sie hatte ihn verdient, und Kapp hatte uns vor ihr erlöst." Er wird seines Amtes enthoben und aus der SPD ausgeschlossen.
Naumburg. Oberbürgermeister Arthur Dietrich beobachtet: "Vormittags Ruhe. Wachsendes Misstrauen gegen die bürgerlichen Volkskreise."
 |
|
Aufnahme
vom Artillerieplatz um 1902, ab 1905 Kaiser-Friedrich-Platz.
|
 |
|
Der Kaiser-Friedrich-Platz wurde 1945 in Heinrich-von-Stephan-Platz
(Aufnahme 2007) umbenannt.
|
Gegen 3 Uhr nachmittags demonstrieren auf dem Kaiser-Friedrich-Platz (Heinrich-von-Stephan-Platz) überwiegend sozialistisch gesinnte Bürger gegen Kapp. Die Vertreter der drei sozialistischen Parteien (SPD, USPD, KPD) halten eine Ansprache. Oberbürgermeister Arthur Dietrich und der Magistrat nehmen an dieser Kundgebung zugunsten der Regierung Ebert-Bauer nicht teil. Robert Manthey (SPD) macht in der Stadtverordnetensitzung am 20. April 1920 darauf Aufmerksam, dass sie gegenüber den Arbeitern immer wieder mit "gewundenen Erklärungen" auftraten. Im Bericht vom 9. April 1920 bekennt sich der Oberbürgermeister gegenüber dem Zivilkommissar des Regierungsbezirkes Merseburg zur rechtmäßigen Regierung. In den Tagen des Putsches vertrauen ihm viele Arbeiter nicht. Selbst zum Volksblatt (13.4.1920) nach Halle war gedrungen:
"Der Herr Oberbürgermeister" hatte "auf die wiederholte Anfrage, ob er hinter der alten Regierung stehe, nicht klipp und klar geantwortet."
Vom Kaiser-Friedrich Platz marschieren tausende Demonstranten zum Markt (Bild), um kurze Ansprachen zu hören.
Gegen 5 Uhr nachmittags begibt sich eine Delegation der Arbeiterparteien (USPD, SPD, KPD) in das Rathaus, um über die Auflösung der Einwohnerwehr zu verhandeln. Sie treffen auf den Oberbürgermeister und Polizeiinspektor. Zugegen ist ausserdem der Kreisrat für die Einwohnerwehren Naumburg Stadt, Naumburg Land und Eckartsberga Max Jüttner. Von dessen übergeordneter Stelle, die Reichs-Zentrale für Einwohnerwehren in Berlin, erging am 13. März 1920 die Aufforderung:
"Bis zur Entscheidung des Volkes bewaffnen sich sämtliche Einwohnerwehren zum Schutz von Ruhe und Ordnung."
"Die neue Regierung hat die Arbeit aufgenommen", "alle Parteien sind zur Mitarbeit aufgefordert".
Das ist eine klare Ermunterung zur Unterstützung von Kapp-Lüttwitz.
An die politische Loyalität von Kreisrat Max gegenüber der rechtmässigen Regierung Jüttner glauben die Kapp-Gegner nicht. "Wir merken ja, dass der Oberbürgermeister und der Kreisrat viel mehr von der Kappsache wissen, als sie zugeben wollen", äussern die Deputierten. Diese politische Einstellung bestimmt ihr Verhalten zur Einwohnerwehr. (Ähnlich schildert es Oberbürgermeister Arthur Dietrich in einem Bericht von April 1920.) Jüttners Erklärung, dass die Einwohnerwehr nicht bewaffnet ist, weil sie ihre Schiessinstrumente nach dem Einsatz immer wieder auf der Dienststelle abgeben, hilft da reichlich wenig, um fehlendes Vertrauen aufzubauen. Die Deputierten beharren auf der Demobilisierung der Einwohnerwehr und verlangen die Herausgabe aller im Rathaus lagernden Waffen, erzielen aber darüber mit dem Rathaus keine Einigkeit. Es kommt zum Streit. Darauf verlässt Kreisrat Jüttner beleidigt das Zimmer und die Verhandlungen müssen abgebrochen werden.
15. März, Montag zurück
Weimar. Die Ereignisse an der Ilm nehmen nachhaltigen und entscheidenden Einfluss auf die politische Einstellung der Naumburger Kapp-Gegner zur Reichswehr. Immer wieder nehmen sie in den folgenden Tagen darauf Bezug.
Der Generalstreik setzt mit voller Wucht ein. Es herrscht eine "geradezu fieberhafte Spannung in der Stadt" (Pfotenhauer). Tausende Bürger folgen dem Aufruf zur Versammlung für 2 Uhr nachmittags. Der Saal des Volkshauses konnte sie nicht alle aufnehmen. So tummelt sich eine grosse Menge auf dem Vorplatz (Buttelstedter Straße). Dann rückte, von Hagenberg gerufen, eine
Gruppe Naumburger Jäger auf Fahrrädern
an und trieb die Ansammlung auseinander. Sie riegelten die Strasse im Bereich zwischen dem Krankenhaus und der Gaststätte Rose ab. Maschinengewehre werden Stellung gebracht. Laute Kommandorufe ergehen, fordern die Menge auf auseinanderzugehen. Nicht alle verstehen sie. Aus der Menge erschallen Rufe des Abscheus und der Verachtung gegenüber dem Militär. Ein Offizier verliert die Geduld und schiesst. Ein Arbeiter streckt ihn mit einem Faustschlag nieder. Auf dem Lastkraftwagen knattert ein Maschinengewehr los. Demonstranten sinken tödlich getroffen zusammen. Hass und Wut kennen keine Grenzen. Mit einem Steinhagel aus den seitlich gelegenen Gärten gehen Bürger auf die Kapp-Söldner los. Zurück bleiben neun Tote und 35 Schwerverletzte. Sarkastisch kommentiert Otto Pfotenhauer: "Dieselben Naumburger Jäger, die vor dem Kugelhagel der Verteidiger der rechtmäßigen Regierung durch falsches Zaudern verschont blieben, scheuten sich einige Tage später nicht, brutal und ohne Gewissenbisse in die Bevölkerung zu schießen." (1973, 18+15)
Berlin. Rädelsführer, die sich in der Verordnung zur Sicherung volkswirtschaftlicher wichtiger Betriebe und in der Verordnung zum Schutz des Arbeitsfriedens unter Strafe gestellten Handlungen schuldig machen, desgleichen die Streikposten, ordnet "Reichskanzler" Kapp an, werden mit dem Tode bestraft. (Brammer 1920, 22) In Deutschlandweit stehen etwa 12 Millionen Arbeitnehmer im Ausstand.
Merseburg. Im Geiseltal (Braunsbedra, Mücheln), Halle, Leuna und Merseburg beginnen die ersten Streiks. Die Bezirksleitung der USPD für Halle-Merseburg [also einschliesslich der Stadt Naumburg] hatte bereits am 13. März alle Arbeiter zum Generalstreik aufgerufen.
In Hohenmölsen, Osterburg, Weißenfels, Zeitz sowie in den Bergarbeiterdörfern Deuben, Luckenau, Teuchern und Theissen finden Protestkundgebungen gegen Kapp statt. (Vgl. Könnemann 1972, 115)
Halle. Zusammen mit der Einwohnerwehr und den Zeitfreiwilligen besetzt die Reichswehr die Stadt. Der Garnisonsälteste Oberst Hermann Czettritz steht auf Seiten der Putschisten. Ihm unterstehen zwei Bataillone des Jägerregiments 31, eine Minenwerferkompanie, eine Geschützbatterie, zwei Reiterschwadronen und die Einwohnerwehren, insgesamt etwa 4 500 Mann. Durch verschiedene Massnahmen deutet er der Bevölkerung unmissverständlich, dass die Reichswehr jede Versammlung und Demonstration unterbinden wird. (Vgl. Dreetz 136/136f.) Während einer Pressekonferenz des Garnisonskommandos Halle (Saale) antwortet er auf Nachfrage eines Journalisten wie er zur Regierung stehe ausweichend. Zivilkommissar Walther Schreiber charakterisiert in Die Revolution in Halle a. S. (1920, 2/3) die Lage "von allem Anfang an dadurch besonders schwierig, dass der Führer des hiesigen Garnisonskommandos seine Pflichten gegenüber der verfassungsmässigen Regierung nicht klar erfüllte."
Zeitz. Die Stadt ächzt unter dem Generalstreik. Fabriken liegen still. Landarbeiter legten die Arbeit nieder. Gas-, Wasser- und Elektroenergieversorgung sind eingestellt. Der Deutsche Beamtenbund Zeitz solidarisiert sich. Auf der Moritzburg (Zeitz) sind etwa 150 Reichswehrsoldaten vom Altenburger Regiment stationiert, das auf Seiten der Regierung Ebert steht. Unglücklichweise sympathisiert der Zeitzer Befehlshaber, Leutnant Schmidt, mit Kapp-Lüttwitz. Deshalb sendet das Regiment zwei Feldwebel an ihn und bittet um Stellungnahme. Schmidt liess sie einfach festnehmen und einsperren. Als die Arbeiter davon erfahren, setzen sie alles daran, die Reichswehrtruppen zu kontrollieren. Noch am Abend wird ein Leutnant Kunze und sechs Soldaten in der Naumburger Straße entwaffnet und festgehalten. (Nach Leopoldt 150)
Weißenfels. Der "Generalstreik [wird] ausgerufen und ein Arbeiter- und Soldatenrat als politisches Streikkomitee gewählt". In der Stadt patrouillieren 300 Arbeiter mit roten Armbinden als Ordnungsdienst. "Straff organisierte Kolonnen marschieren auf den Ausfallstrassen der Stadt in die umliegenden Dörfer, um hier bei den Bauern die versteckten Waffen und die Munition abzuholen." (Beuthan 1956, 107f.)
Die Bezirksleitung der USPD in Halle beschliesst, jeder soll die Arbeit einstellen, um die "Diktatur der deutschnationalen Monarchisten" zu verhindern. In Zeitz und Weißenfels existieren politisch und personell starke USPD-Ortsgruppen mit vielen Anhängern. Die USPD-Zeitz nimmt unter den Kreisen mit den höchsten Stimmanteilen in Deutschland Platz drei ein. (Vgl. Falter 127)
 |
|
Reichskrone
(Bismarckplatz /
Theaterplatz) um 1910 |
Naumburg. Um 10 Uhr morgens beginnt in der Reichskrone die grosse Volksversammlung. Zentrale Instanzen spielen bei der Vorbereitung eine wichtige Rolle. "Als der Staatsstreich Kapp-Lüttwitz bekannt wurde", erzählt später Walter Fieker aus der Moritzstrasse 42 dem Staatsanwalt, "erhielten wir von der Gewerkschaftskommission der Gewerkschaft in Berlin und von den Parteileitungen der Unabhängigen [USPD] und den Mehrheitssozialisten [SPD] die Anweisung, in den Generalstreik zu treten." (Vgl. Vernehmung)
Ungefähr 1 000 Bürger, Arbeiter aus den Betrieben und die Stadtangestellten der Naumburger Strassenbahn folgen dem Ruf von SPD, USPD und KPD. Den Promotoren liegt die Erklärung des Aktionsausschusses für Mitteldeutschland und der Streikleitung von Halle vor, wo es heisst:
Legt geschlossen die Arbeit nieder.
Das Wirtschaftsleben muss von jetzt an Ruhen.
Die Versammlung beschliesst den Generalstreik.
Und damit ist der Grundkonflikt konstituiert. Im ausgerufenen Generalstreik wittern die hohen Reichswehrkommandeure eine bolschewistische Attacke. Generalmajor Hagenberg, stellvertretender Kommandeur der Reichswehrbrigade XVI., erteilt mit den Verschärften Bestimmungen über den Ausnahmezustand vom 14. März die Anweisung:
"Verboten ist durch Wort und Schrift oder sonstiger Art zur Niederlegung der Arbeit oder zur Verweigerung der Wiederaufnahme der Arbeit aufzufordern."
Das kollidierte nicht nur mit dem Streikaufruf von Regierung und Gewerkschaften. Auch die Deutsche Demokratische Partei (DDP) stiftete am Abend des 14. März in Halle Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Angestellte dazu an, jede Arbeit mit Ausnahme der lebenswichtigen Betriebe einzustellen.
In Naumburg versehen lediglich die Mitarbeiter der Stadtwerke weiter ihrem Dienst. In den Schulen fällt der Unterricht aus.
Vom Stadtoberhaupt verlangt die Volksversammlung vom 15. März ultimativ die Auflösung der Einwohnerwehr, was er und Max Jüttner ablehnen.
Wenn wir die Macht haben, dann gehen sie auf Urlaub!
 |
feuert der Vorsitzende des Aktionsausschusses in Richtung Oberbürgermeister Arthur Dietrich.
Der Sprecher der Sozialdemokratischen Partei kritisiert die Haltung von Oberbürgermeister und Kreisrat.
Vier Wochen nach der grossen Volksversammlung in der Reichskrone verfasst der Oberbürgermeister über deren Verlauf folgendes Summary:
"In Berlin hat sich eine reine reaktionäre Regierung der Gewalt bemächtigt, die das alte Regiment der Knute wieder aufrichten will. Die Arbeiter sollen wieder wie einst als Sklaven gedesselt und niederkartäscht werden. Die alte verfassungsmässige Regierung hat sich nach Dresden begeben. Die Republik ist in Gefahr. .... Der Generalstreik ist verkündet. Der Stadtverordnete Heinrich [USPD] tritt ein für die Aufrichtung einer Räterepublik. Die Zeit ist gekommen, wo das Proletariat das Ruder in die Hand nehmen müsse. In spätestens 8 Tagen sei Deutschland Räterepublik. Es lebe die Weltrevolution."
Demnach fielen die Worte von der
Räterepublik und Weltrevolution.
Damit nicht genug: "Die Errichtung der Diktatur des Proletariats, tritt bei den radikalen Rednern als Zweck der Bewegung klar zu Tage." Sie "werden mit Beifallskundgebungen begleitet, insbesondere mit dem auf dem Oberbürgermeister [laut 9.4.1920], den Kreisrat [Max Jüttner] und den Polizeiinspektor sich beziehenden Rufe:
an die Latern!
und dergleichen mehr."
Bei den meisten Kapp-Gegnern finden (nach bisher vorliegenden Nachrichten) derartige Grobheiten keinen Widerhall. Dennoch erschüttern derartige linkspolitischen Ausfälle die konservative Bürgerschaft und Verantwortlichen der Stadtverwaltung. In gewisser Weise schaden sie der gerechten Sache, einer verfassungstreuen Regierung zur Hilfe zu kommen.
|
Räterepublik, Diktatur des Proletariats und Befreiung von aller Knechtschaft mobilisieren viele politisch denkende Arbeiter zum Widerstand gegen Kapp. Eine politische Bewegung braucht Visionen und Ideale. Und welche konnten das nach Krieg, Hunger, Wohnungsnot und einsetzender Arbeitslosigkeit wohl sein? Indes schob man jetzt die Weltrevolution noch ein bisschen hinaus, um die verfassungsmässige Regierung zu unterstützen. Gewiss stiess dies zunächst bei vielen Kapp-Gegnern nicht auf Gegenliebe, wenn sie an die Rolle der "militarisierten Pseudosozialisten" (Ströbel 1920) beim Aufbau der Reichswehr dachten. Schwer quälten sie die Erinnerungen an den November, speziell die Zusammenarbeit von Friedrich Ebert, Mitglied des Rates der Volksbeauftragten, mit General Wilhelm Groener. Leider sind aus diesen Tagen die Gedanken und Diskussionen hierzu nicht überliefert. Aber das es sie gegeben hat, ist sehr wahrscheinlich. Darauf deutet die Erklärung des Naumburger Aktionsausschuss vom 18. März 1920 hin, die im Abschnitt "Max Jüttner treibt der Wille zur Tat" zitiert wurde. Zugleich formuliert sie ein starkes politisches Motiv für die SPD-Kritiker aus der Linken, sich trotz alledem f ü r die Regierung Bauer einzusetzen. Und die Idee der Weltrevolution tragen Otto Grunert, Robert Manthey oder Otto Teichmann, alle SPD, wieso nicht mit. Auch Doktor Kurt von der Demokratischen Partei unterstützt mit seiner Rede in der Reichskrone die verfassungsmäßige Regierung. Er warnt aber davor, schlicht dem russischen Vorbild nachzueifern.
Einzelne sozialistisch-kommunistische Ideen wirbelten, ohne sich festzusetzen, im politischen Raum herum. Trotzdem suchte der Naumburger Aktionsausschuss nicht - wie Helmut Böttcher in Kapp-Lüttwitz-Putsch. Generalstreik und Bürgerkrieg. Die Wahrheit über die Ereignisse in Halle (Saale) und Mitteldeutschland (1920) behauptet - die "blutige Auseinandersetzung". Der Widerstand gegen Kapp trägt reaktiven Charakter und diente, auch wenn es diesem oder jenem nicht ganz leicht fiel, der Unterstützung der demokratisch gewählten Regierung. So berichten es die bisher vorliegenden Dokumente.
Die revolutionären Ideen verschwanden natürlich nicht. Auf der ausserordentlichen Generalversammlung der USPD für den Naumburg-Weißenfels-Zeitzer Kreis am 10. April 1920 referiert Bernhard Düwell über den Plan für eine sozialistische Arbeiterregierung. Am Horizont sieht er die "untrüglichen Zeichen der Weltrevolution", die aber nur etappenweise vollzogen werden kann. Das greift der politische Gegner gerne auf, um die Gefahr der Bolschewisierung zu beschwören. Damals trugen diese Visionen wesentlich zur Mobilisierung der Kapp-Putsch-Gegner bei. Und sie sind auf dem Hintergrund des Desasters, das der Krieg allen Ortes angerichtet hat, nur zu verständlich.
Schliesslich wählt die Versammlung folgende Mitglieder des Aktionsausschusses:
Maler
Leopold Heinrich, USPD, Vorsitzender,
Dompredigergasse 16,
Schneidermeister Robert Manthey, SPD,
Große Jägerstraße 51,
Schriftsetzer Franz Neubert, KPD,
Windmühlenstraße 6a,
Tischler Paul Kynast, USPD,
Schriftsetzer Otto Teichmann, SPD,
Peter-Paulstraße 14,
Kammmacher Franz Wieglepp, KPD,
Moritzstraße 8, und
Schriftsetzer
August Winkler, SPD,
Schönburger Straße 27.
Nach Eugen Wallbaum (SPD) waren hier je fünf Genossen der SPD und USPD vertreten. Andere Quellen sprechen von einem von Sechs-zu-Sechs-Verhältnis. Es fallen noch die Namen Hugo Schwarz (USPD), Louis Knauer (SPD) und Weineck. Als Vorsitzender des Arbeiterrates fungiert Leopold Heinrich. Sein Nachfolger ist - laut einer unterzeichneten Erklärung vom 21. Dezember 1919 - August Winkler (SPD), der als mehrheitssozialistisch eingestellt gilt. (In der Vernehmung am 20. März 1920 durch Staatsanwalt Hardt gibt Walter Fieker zwei Mitglieder mit "Mir zur Zeit unbekannt" an. Die Akte nennt an anderer Stelle noch die Namen "Hoffmann" und "Robert Manthey".)
Einige Protagonisten des Naumburger Widerstandes gegen Kapp-Lüttwitz sind Mitglieder der KPD oder stehen dieser Partei zumindest nahe. Darin könnte man einen Widerspruch zu den Zielen des Aktionsausschusses vermuten. Bekanntermassen befinden sich Spartakisten / Kommunisten noch im embryonalen Entwicklungsstadium. Allerdings rekrutieren die sich personell nicht unerheblich aus dem Kaderbestand der Sozialdemokratie, was die Sache nun schwierig macht. Jedenfalls "gab es zu dieser Zeit noch keine KPD", sagt Leopold Heinrich (Wsf 16). "Es gab nur einzelne Genossen, die der Kommunistischen Partei Deutschland in Leuna angehörten." In Naumburg verfügen im linken politischen Spektrum die SPD, USPD und das örtliche Gewerkschaftskartell über politische Gestaltungspotentiale.
Die Macht der Aktionsausschüsse wird öfters überschätzt, zum Beispiel, wenn Die Schlacht um Halle (1956, 89) meint: "Die Aktionsausschüsse übten die Funktionen von Arbeiterräten aus und hatten in allen Orten des Bezirkes [Halle] die Macht vollständig in den Händen." - Für Naumburg, Weißenfels oder Zeitz lässt sich das so nicht verifizieren.
Am Marktbrunnen
Nach Beendigung der Versammlung in der Reichskrone laufen der Maler Walter Fieker, Tischler Otto Grunert und Schriftsetzer Franz Neubert zum Rathaus, um mit dem Oberbürgermeister zu verhandeln. Zugegen ist der Landrat und Kreisrat Max Jüttner. Sie fordern die Bewaffnung der Arbeiter. Oberbürgermeister Arthur Dietrich wäre aber lediglich bereit, fünfzig Arbeiter bis spätestens 2 Uhr nachmittags in die Einwohnerwehr aufzunehmen.
Mit diesem Verhandlungsergebnis begibt sich Walter Fieker im Auftrag der Deputation hinaus auf den Markt [Stadtplan], wo ihn eine grössere Ansammlung von Bürgern erwartet.
 |
|
Marktbrunnen, etwa um 1910. Blick vom Markt in Richtung Jakobsstrasse.
(Bild digital bearbeitet.)
|
Es ist 12 Uhr mittags. Ein Mann aus der Moritzstrasse 42, von dem man sagt, er sei KPD-Mitglied, steigt auf den Rand des Marktbrunnens und informiert über den Stand der Gespräche: "…. unsere nochmaligen Verhandlungen mit dem Oberbürgermeister hat nun wieder ein Schritt vorwärts gemacht. …. wir werden in die Einwohnerwehr aufgenommen. Wer sich dazu melden will, hat sich bis 3 Uhr nachmittags auf dem Rathause in die Liste eintragen zu lassen. Die Eintragung muss 3 Uhr nachmittags vollendet sein. Ich fordere Euch nun auf in Ruhe auseinander zu gehen, Ruhe und Ordnung [zu halten] und nachher Euch eintragen zu lassen."
Aus der Menge erschallen spontane Rufe nach der Räterepublik. Schon bei den Verhandlungen am 14. März mit dem Oberbürgermeister schwirrte dieses Wort wie ein Schwert durch den Raum. Der Vorsitzende des Naumburger Gewerkschaftskartells (1921) Gottfried Rublack (SPD) lässt am 20. März bei einer ähnlichen Gelegenheit den Satz heraus:
"Meine Herren, wir wollen uns doch nichts vormachen, die Räterepublik kommt, das ist doch nicht aufzuhalten."
Fieker (SPD, KPD) endet nach Aussage des Zeugen Rittmeister a.D. Helmut Kumwade mit:
"Es lebe die freie deutsche Republik."
Das war keine Brandrede. Aus der Menge schallen Zurufe, die die Entwaffnung des Militärs und der Polizei verlangen. "Die Menge lachte mich aus", merkte Fieker [Bild]. Er war ihnen nicht radikal genug. Nach seiner Verhaftung am 19. März wegen Landfriedensbruch sagte Rittmeister a. D. Kumwade vor Staatsanwalt Hardt (Naumburg) als Zeuge aus: "Ich hatte nicht den Eindruck gehabt, als wenn die Worte eine aufreizende Wirkung ausüben sollten." Walter Fieker gehörte später zu den aktivsten KPD-Mitgliedern der Stadt, wurde aber noch auf der SPD-Kreis-Generalversammlung am 27. Juni 1920 in Zeitz als Vertreter der Saalestadt in den Zentralvorstand gewählt (Leopoldt 1931, 154).
Nach dem Abgang von Fieker, reisst USPD-Mann Paul Heese (13.3.1881-19.3.1920) aus der Michaelisstrasse 82 das Wort an sich und fordert die Menge dazu auf, gebt euch "nicht mit den 50 Gewehren zufrieden", verlangt mehrere Hundert. Über Helmut Böttcher (1920, 90) sind von ihm noch die Sätze überliefert:
"Es gibt für uns jetzt nur ein Ziel: Diktatur des Proletariats. Um dies zu erreichen, dürfen wir vor einer blutigen Auseinandersetzung nicht zurückschrecken."
Der 39-jährige Buchhändler erhält viel Zustimmung.
Im Rathaus
Dann gehen Fieker, Neubert und Heese wieder ins Rathaus und diskutieren mit Arthur Dietrich weiter. Erneut verlangen sie die Bewaffnung einiger hundert Arbeiter. Zwischendurch geht Heese immer wieder zu den Demonstrierenden auf den Markt. Einmal kehrte er in das Verhandlungszimmer zurück und rief:
Sie haben nur noch 5 Minuten Zeit!
Vorher gab er der Menge die Weisung:
Wenn ich in 5 Minuten nicht mehr wieder hier bin,
stürmt ihr das Rathaus!
 |
|
Markt
mit Brunnen
und Rathaus (2006) |
Dann verlässt er den Verhandlungsraum wieder, um erneut zum Markt hinauszugehen, wo er jetzt der Menge mitteilt:
"Die Zeit zum Rathaussturm ist noch nicht gekommen, entweder kriegen wir Gewehre oder nicht. Kriegen wir solche, dann ist Naumburg erledigt!" (Dietrich 9.4.1920)
Am ersten Tag des Generalstreiks fährt Leopold Heinrich (USPD) mit dem Fahrrad nach Zeitz. Er bespricht mit Albert Bergholz die politische Lage. Als er am Abend zur Sitzung des Aktionsausschusses in den Goldenen Hahn zurückkehrt, "war es inzwischen hoch hergegangen". "Die SPD war nicht einverstanden", berichtet er Jahre später, "mit dem Vorgehen von He[e]se, der die Arbeiter zum Kampf gegen die Reaktion bewaffnen und mobilisieren wollte." (Wsf. 17) Die Mehrheitssozialisten, voran die Stadtverordneten August Winkler und Stadtrat Robert Manthey, wollten eine Überhitzung der Stimmung vermeiden.
Am nächsten Tag (16.3.) findet am selben Ort eine Funktionärskonferenz statt. Der Aktionsausschuss beschließt, offensichtlich in Reaktion auf die Schiesserei der Reichswehr auf dem Markt, die Arbeiter am Nachmittag zu bewaffnen. Die militärische Führung übernehmen Walter Fieker und Paul Heese.
Die Bürgerwehr gibt am 15. März in Weißenfels ihre Waffen ab. Ihr nachzueifern, lehnt das Naumburger Rathaus strikt ab. Vor dem Gefängnis protestieren abends immer wieder Kinder, Frauen und Halbwüchsige. Allein wenn schon der Stacheldrahtzaun demoliert, könnte eine gefährliche Situation entstehen. Laut Mitteilung des Ersten Staatsanwalts vom 12. April 1920 drohten die Demonstranten, die Wachen aufzuhängen. Um die Sicherheit in und um der Haftanstalt aufrechtzuerhalten, so kalkulierte wahrscheinlich das Rathaus, braucht es die Einwohnerwehr.
In der Wache des Rathauses tat die Sipo Dienst. Was unternahm sie eigentlich in den kritischen Tagen? "Während der Unruhetage trug Hauptmann Schmidt [von der Sipo] eine offenbare Ratlosigkeit zu Schau", klagt am 3. Mai 1920 Bürgermeister Karl Roloff beim Regierungspräsidenten in Merseburg. Zuvor gewann er im Gespräch mit ihm den Eindruck, dass er "zur Führung der Polizeitruppe nicht imstande sei". Seine Untergebenen nehmen die Befehle nicht ernst. In der Nacht führt er nicht die Hundertschaft, sondern hält sich zu Hause auf. Ihn wirft man Feigheit vor. Infolge des Verhaltens ihres Kommandeurs, erfüllte die Sipo während des Kapp-Putsches aus Sicht der städtischen Administration nicht ihre Aufgaben. Dahinter könnten sich jedoch auch andere Ursachen verbergen, als Karl Roloff sie ermittelte. Es gelang aber nicht, dies weiter aufzuklären.
Inzwischen war es 8 Uhr abends. Die Verhandlungen im Rathaus neigen sich dem Ende zu. Der Wehrberatungsausschuss ist bereit, sofort 100 Arbeiter ohne Prüfung ihrer Zuverlässigkeit in die Einwohnerwehr einzugliedern. Ihre Auswahl erfolgt durch die Arbeiterführer. Noch am selben Abend können sie 54 Personen rekrutieren. Es gibt Schwierigkeiten. "Sehen sie sich vor, sagt ein Mehrheitssozialist gegenüber der Polizeiwache, man hat ihnen die Übelsten herausgesucht. Tatsächlich waren unter den 54 aufgenommenen Leuten," erzählt Oberbürgermeister Dietrich (9.4.1920), "21 die wegen gemeiner Verbrechen und Vergehen, insbesondere wegen Verbrechen und Vergehen gegen das Eigentum nicht unerheblich und zumeist mehrfach vorbestraft waren. Von den sich Meldenden erschienen nur wenige zum Dienst".
16. März, Dienstag zurück
Kapp und Lüttwitz lassen z massenhaft Flugblätter abwerfen auf denen sie versprachen: "Alle Freiheiten des Arbeiters blieben unangetastet bestehen. An eine Aufhebung des Betriebsrätegesetzes wird nicht gedacht." (Flugblätter)
In Hefta und Eisleben kämpfen Ortsansässige gegen die Reichswehr.
Halle (Saale). Der Garnisonsälteste und Kommandeur des Infanterie-Regiments 21 Oberst Hermann Czettritz proklamiert den Ausnahmezustand und stellt sich offen auf die Seite der Putschisten. Seine Truppen besetzen das Hauptpostamt, Gewerkschaftshaus und Volksblatt. Der Marktplatz wird abgespürrt. Zuwiderhandelnde werden erschossen. In aller Frühe werden die Redakteure des ,,Volksblattes” Hennig, Bock, Kasparek und Scholem verhaftet. Festgenommen wurden ebenfalls die Genossen Hildebrandt, Osterburg, Bowitzky und von der KPD Tominsky, ausserdem die Demokraten Doktor Schreiber und Redakteur Helms. Die Verhaftung des Abgeordneten Genossen Hennig und des Demokraten Doktor Schreiber laut Anordnung des Polizeidirektors Könnemann war ein offener Verfassungsbruch. In "Vierzehn Tage ohne Zeitung ...." fordert das Volksblatt Halle am 30. März 1920 zu klären, wieweit Oberbürgermeister Rive hierfür verantwortlich ist. Es beginnen heftige militärische Kämpfe zwischen Kapp-Gegnern einerseits und Reichswehr, Zeitfreiwilligen und Einwohnerwehr andererseits.
 |
|
Blick
in die Jüdenstrasse (Weißenfels, 2012)
|
Weißenfels. zurück In der 15 Kilometer von Naumburg entfernten Nachbarstadt, meldet der Naumburger Aktionsausschuss, kommt es zu Kämpfen. Mit einer roten Binde am Arm versehen etwa 300 Arbeiter den Ordnungsdienst in der Stadt. Bei der Erstürmung des Bahnhofs durch die Arbeiter kommt es zu einem heftigen Feuergefecht mit der Sipo. Sieben Kapp-Gegner verlieren ihr Leben. (Vgl. Zeitzer 215)
Auf dem Markt und den einmündenden Strassen stehen gegen 3 Uhr nachmittags viele Streikende umher und warten auf den Beginn einer angekündigten Versammlung. Vor dem Eisenwarengeschäft Hoyer in der Jüdenstrasse fährt ein SIPO-Kommando vor. Zwei schwer bewaffnete Männ gehen in das Geschäft, während einer das Fahrzeug und die Pferde bewacht. Um den Wagen steht eine erregte Menschenmenge. Im Geschäft fallen plötzlich Schüsse. Albert Engel und Hildebrandt sind tödlich getroffen; Kurt Haenschke erhielt einen Brustschuss (vgl. März 1920, 13). Die Menschenmenge stürmt das Geschäft. Umgehend rückt für die Sipo aus dem Schloss Verstärkung an. Am Eingang der Jüdenstrasse bauen sie ein MG auf. Durch die Strasse schallt das Kommando Straße frei!.
Ein Arbeiterkommando entwaffnet die "reaktionären Truppen" (Leopoldt) auf dem Bahnhof. Dabei wurden sieben Arbeiter getötet, eine Anzahl verwundet (Leopoldt 151). Die SIPO-Außenkommandos in der Post und im Bahnhof ziehen in das Schloss zurück.
Am Abend sprechen und diskutieren Bürger im Volkshaus über die Ereignisse. Auf der Versammlung referieren Frau Marie Wackwitz (1865-1930) und Friedrich Demberger (SPD).
Es
schadet nichts, wenn
sich die Batterie einmal zeigt. (Oberbürgermeister
Arthur Dietrich) zurück
Überblick
 |
|
Gasthaus
Goldener Hahn, damals Roonplatz 1, heute Am Salztor 1 (2005)
|
 |
|
Innenansicht
vom Gasthaus zum Goldenen Hahn, damals Roonplatz 1,
heute Am Salztor 1 (etwa um 1930)
|
Die Naumburger Behörden sperren den Vertrieb des Volksboten, der Arbeiterzeitung aus Zeitz.
Im Gasthaus Goldener Hahn tagt der Aktionsausschuss (Streikleitung) ohne Unterlass. Vor dem Gebäude fahren Soldaten der Reichswehr auf. Tags darauf beschreibt der Naumburger Aktionsausschuss die Ereignisse so:
"Gestern Vormittag 11 Uhr traf eine Abteilung Militär ein und nahm Aufstellung vor dem Schwurgericht. Auf sofortiges Befragen erklärte der Führer, dass er im Namen des Ortskommandanten den Belagerungszustand über Naumburg verhänge. Wir weisen besonders darauf hin, dass sich die Naumburger Gewerkschaftskollegen nicht daran zu stossen brauchen. Gleichzeitig fordert er die Versammelten auf, sofort die Strasse frei zu geben. Kollege [Leopold] Heinrich erbat sich für einige Minuten Zeit, um die Leute aufzuklären und zu zerstreuen; es gelang ihm. Es musste aber den Führer mehrmals bitten, einen gewissen Leutnant Achilles zurückzuhalten, damit keine blutigen Exzesse entstehen. Daraufhin wurde dem Führer bedeutet, doch mit seinen Leuten abzurücken, damit wieder Ruhe und Ordnung eintrete. Der Hauptmann erklärte darauf, er sei überzeugt, dass das Versprechen gehalten werde und rückte ab. Kurze Zeit drauf knatterte Maschinengewehrfeuer auf dem Marktplatze und 14 Bürger Naumburgs brachen in ihrem Blute zusammen."
 |
|
Emil Schurzfeld Emil Schurzfeld starb am 14. April 1920 an den Folgen seiner Verletzung im Naumburger Krankenhaus |
|
Die Kugeln trafen die Arbeiter Emil Schurzfeld und Gärtner Hoyme. "Mehrere Einwohner wurden verletzt und teils schwerverwundet." (Wallbaum)
Oberbürgermeisters Arthur Dietrich zieht Bilanz: "Im Wesentlichen durch Querschläger werden 13 Leute verwundet. 2 Verwundete erliegen ihren Verletzungen nach wenigen Tagen. Von den Verbleibenden sind 4 schwer und 7 leicht verletzt." Das Mitteilungsblatt des Aktions-Ausschusses Naumburg a.S. meldet am 17. März 1920:
"14 Bürger Naumburgs brachen in ihrem Blute zusammen". Acht sind schwer verletzt.
"Der Arbeitskollege [Elektrotechniker] Paul Thieme [23 Jahre alt] ist den gestrigen Vorgängen auf dem Markplatz zum Opfer gefallen. Die organisierte Arbeiterschaft betrauert ihn aufs tiefste und wird sein Andenken stets in Ehren halten."
Details
A) Die Lage um das Gefängnis
Vor dem Gefängnis demonstrieren Bürger gegen die lange Dauer der Untersuchungshaft von einer größeren Zahl von Personen, die seit dem März 1919 hier inhaftiert sind, weil sie vermutlich an Streiks und den schweren Unruhen im Februar / März 1919 in Zeitz und Mücheln beteiligt waren. Erst am 6. Mai 1920 sollte dann ihr Strafprozess eröffnet werden. "Es sammelten sich Scharen von Arbeitern an, einige Arbeiter stellten die Offiziere zur Rede", hält die Chronik von Adolf Leopoldt (1930, 152) fest. Viele kamen von auswärts, Zeitz, Weißenfels, Hohenmölsen. "Wiederholt wurde vor dem Gefängnis die Aufforderung laut," rekonstruiert Kreisrat Max Jüttner das Geschehen im April 1920, "die Gefangenen, deren das Naumburger Gefängnis eine grosse Anzahl aus dem benachbarten Industriebezirk beherbergt, freizugeben, andernfalls würde das Gefängnis gestürmt.
Die Abteilung der Einwohnerwehr die das Gefängnis bewacht, fühlte sich zeitweise stark bedrängt. Sie bat wiederholt, den Platz vor dem Gefängnis räumen zu lassen, da sonst ein Ansturm gegen das Gefängnis und damit Blutvergiessen unvermeidlich sei." Das bereitete dem Oberbürgermeister Arthur Dietrich und dem Magistrat ernste Sorgen.
Zweifellos würde die Stürmung des Gefängnisses die allgemeine Sicherheit der Stadt gefährden und militärisch Lage in nicht vorhersehbarer Weise verändern. Jüttners Hinweis, Diese Meldungen wurden an das Garnisonskommando weitergegeben, deutet darauf hin, dass dies beim folgenden Aufmarsch der Truppen eine Rolle spielte.
B) Aufmarsch der Truppe
In der Stadt gehen Gerüchte um,
"dass die anwesende Batterie des Jägerbataillons zu den Spartakisten übergegangen sei." (Kreisrat)
"Auch dies wurde dem Garnisonskommando gemeldet, welcher sich daraufhin nach vorheriger Mitteilung an den Oberbürgermeister [Dietrich] und den Kreisrat [Jüttner] entschloss, die Batterie durch die Stadt und am Gefängnis vorbeimarschieren zu lassen."
"Der Herr Oberbürgermeister, der auf wiederholte Anfrage, ob er hinter der alten Regierung stehe, nicht klipp und klar geantwortet hatte, war scheinbar übernervös geworden und ging auf den Vorschlag des Majors Wiesners, die Batterie einmal durch die Stadt zu führen, mit den Worten ein:
Es schade nichts,
wenn die Batterie sich einmal zeigt." (Naumburg)
Schliesslich marschiert die II. Abteilung des Artillerie-Regiments 16, das unter dem Kommando von Major Wiesner steht, über den Lindenring, Herrenstraße weiter zum Markt vor [Stadtplan].
C) Herrenstrasse
In der Herrenstrasse bedrängen Bürger die Reichswehr. Es kommt zum Gerangel. Darauf ist das Militär, hervorgegangen aus dem ehemaligen Freiwilligen Landesjägerkorps, gut vorbereitet. Ihr Kommandierender Generalmajor Georg Maercker (1919, 323) veröffentlichte am 31. März 1919 folgende Anweisung:
"Beim Marsch durch gedrängte Menschmassen entsteht leicht die Gefahr, dass die Truppe so eingekeilt wird, dass der Waffengebrauch unmöglich wird und die Masse der umklammerten Truppe die Waffen entringt. Sie muss sich also so viel Ellbogenfreiheit verschaffen, dass sie auch bei angriffsweisem Verhalten der Bevölkerung ihre Waffen gebrauchen kann und dass nicht einzelne Teile von ihr abgedrängt und entwaffnet werden können."
Ein Teil der anrückenden Militärkolonne wird abgeschnitten und mit Entwaffnung bedroht. Die Vorgänge in der Herrenstrasse schildern Walter Fieker, Max Jüttner und Leopold Heinrich. Ihre Aussagen sind nicht völlig kohärent und unter der Fotografie "Herrenstrasse" wiedergegeben.
 |
|
Herrenstrasse,
Naumburg, 1918 (Siehe Bildnachweis unten.)
|
|
".... von dem bedrängten Militär", schreibt Walter Fieker (Naumburg) im April 1920 aus dem Gefängnis in Naumburg, wurde "auf die Menge in der Herrenstrasse geschossen". Ein Teil der Kolonne wird abgeschnitten und mit Entwaffnung bedroht. "Die Truppe war beim Marsch durch die Herrenstrasse nach dem Markt beschimpft, mit Entwaffnung und der Rest mit Umzinglung bedroht worden", notiert am 20. April 1920 Max Jüttner, Kreisrat für die Einwohnerwehren in den Kreisen Naumburg Stadt, Land und Eckartsberga. Leopold Heinrich (USPD) bemerkt hierzu: "Die Truppe war durch die Herrenstrasse gezogen, und die Menschen sind über den Quirl gegangen und waren dann auch in der Herrenstrasse. Diese war zu eng, und so wurden die letzten von der Truppe abgedrückt." (Wsf 17) |
D) Im Zentrum der Stadt
Auf dem Markt bezieht die Reichswehr um das Rathaus Stellung. Sie postiert an der Ecke Markt-Marienstrasse einen Maschinengewehr-Trupp. Die "Vertrauensleute aus der Zivilbevölkerung" sind bereits eingetroffen, "um die Hetzer in der Menge festzustellen .... ".
Die Reichswehrbrigade XVI. (ehemals Freiwillige Landesjägerkorps) war militärtaktisch durch ihren Kommandeur Generalmajor Georg Maercker (1919, 323f.) auf den Kampf gegen die Bürger vorbereitet worden. Eine am 31. März 1919 entworfene Dienstvorschrift gibt folgende Anweisung:
Es ist darauf zu achten, dass Teile der Truppe nicht abgedrängt und entwaffnet werden können. "Deshalb ist vorerst nach dreimaligen Trommelwirbel oder Trompetenstoß die Aufforderung zu erlassen, die Straße zu räumen. Kommt die Menge der Aufforderung nicht nach, so rückt die Truppe vor, die Aufforderung andauern wiederholend, vor allem dort, wo die Möglichkeit die Menge besteht, in Seitenstraßen abzubiegen. Gehorcht die Menge der Aufforderung nicht, was erfahrungsgemäß meist der Fall ist, so pflanzt die Spitze das Seitengewehr auf, dann werden dahinter auf Befehl des Kompanieführers einige Schüsse in die Luft abgegeben, und nun drängt die Spitze vor, vorerst den Kolben, bei Widerstand das Bajonett gebrauchend. ...."
 |
|
Ecke
Markt / Marienstraße (2006)
|
Die Menge johlt und beschimpft das Militär, sie droht mit der Umzingelung, illustriert Wochen später Arthur Dietrich das Geschehen auf dem Markt. Welche Gefahr geht aber von unbewaffneten Bürgern für eine mit schweren Waffen ausgerüstete militärische Einheit aus, möchte man ihn fragen. Freilich bringen sie dem Militär verbal und nonverbal Abneigung und Missachtung entgegen. Und das trifft die Grauen, die schon länger um ihr Selbstbewusstsein ringen, empfindlich. "Die Sozialdemokratie hat den Offizier schon im Frieden herabgesetzt, bei der Revolution misshandelt," zetert eine Denkschrift von 1919. Eine derartige Respektlosigkeit und Aufsässigkeit gegenüber dem Militär sah die Garnisonsstadt Naumburg seit der 48er Revolution nicht mehr. Immer waren die Bürger so stolz auf ihre Offiziere, die Kasernen und Kadette. Und jetzt das: Nach der Aufforderung zum Auseinandergehen, "nur auspfeifen, Gejohle, Bedrohung und Rufe: Ihr schiesst ja doch nicht!". Unüberhörbar, die Zeichen der Geringschätzung und Ablehnung. Bereits beim Bergarbeiterstreik 1919 in Zeitz schlug der Widerwille gegenüber der Reichswehr in Hass um. Viele Regierungs-Demokraten und Generäle wollten das nicht wahrhaben, waren unfähig oder unwillig, daraus für die politische Führung des Staates Schlussfolgerungen zu ziehen. "Die Republik hat es nicht verstanden," hält Carl von Ossietzky 1932 Rückschau (10.5.1932, 280), "den spontanen Antimilitarismus, den unsre Heere aus dem Kriege mitbrachten, im eignen Interesse zu fundieren. Sie hat ihn, im Gegenteil unterdrückt, wie sie nur konnte …."
Politiker wie Bernhard Düwell betrachteten das Verhältnis von Regierung und Reichswehr, die "erstaunliche Militärfrömmigkeit" des Reichspräsidenten (Scheidemann 2002, 137), stets kritisch. Auf der außerordentlichen Generalversammlung der USPD für den Kreis Naumburg-Weißenfels-Zeitz am 10. April 1920 beanstandet er: "Die Politik der Bauer-Noske war stets die Vorbereitung für den Putsch, indem sie besonders die konterrevolutionären Truppen zu Garantien der Demokratie stempelten."
In der Machtperspektive erscheint das Bündnis der Regierung mit den alten kaiserlichen Offizieren alternativlos. Nur so, glaubt sie, kann sie ihrer Autorität Durchsetzungskraft verschaffen. Dass die demokratische Idee sich dabei en passant gründlich blamiert, kümmert viele nicht. Ordnungspolitiker nehmen den Kollateralschaden für die junge Republik in Kauf. Es bleibt nichts anderes, argumentieren sie, will man das politische System stabilisieren.
Bis zum 13. März 1920 funktionierte die Aktionseinheit von Regierung und Reichswehr als passables Tauschgeschäft: Legalität, die nach dem Krieg und Versailles für die Reichswehr schwer zu haben, gegen Gewalt, welche die Regierung zur Disziplinierung der Streikenden und Aufsässigen braucht.
Herren-Attitüden, wilhelminische Manieren und Untertanengeist bedrohen die Hoffnung des demokratischen Aufbruchs. Verstehen die Kommandeure der Reichswehr die Begeisterung für die "Revolution"? Welchem sozialen Milieu entstammen sie eigentlich? "Hatten wir Offiziere aus Arbeiterkreisen? Nein, die hatten wir nicht", ruft die Reichstagsabgeordnete Marie Juchasz (1879-1956) den Abgeordneten der Weimarer Nationalversammlung am 19. Februar 1919 zu. Reichspräsident Friedrich Ebert lässt die Chance für den Aufbau einer republikanischen Armee vorüberziehen und ergibt sich ehrerbietig der alten Offizierskaste. Jetzt drängen sich auf den Markt diese Versäumnisse zwischen Reichswehr und Bürgern.
 |
|
Naumburg
mit Markt,
Rathaus und Wenzelskirche (vor 1945) |
Dreimal hintereinander, begleitet von einem Trompetensignal, fordert ein Offizier zum Auseinandergehen auf. "Daraufhin ergeht der Befehl Feuer. Die Soldaten zielen in die Luft, nur wenige auf das Pflaster." (Dietrich 9.4.1920) Aus Richtung Rathaus pfeifen Kugeln durch die Luft. Später bestreiten das die Offiziellen. Schaufensterscheiben gehen zu Bruch. Geschosse schlagen in die Wenzelskirche ein.
"Erneut kam die Meldung zum Aktionsausschuss [im Goldenen Hahn]," wirft Eugen Wallbaum (SPD) ein, "dass auf dem Markt geschossen wurde. Die Genossen setzten sich in Bewegung und gingen zum Oberbürgermeister, um ihn für sein Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen. Doch das Rathaus war mit Maschinengewehren besetzt und die Genossen mussten sich den Zutritt in das Zimmer des Oberbürgermeisters erzwingen."
• "Der Aktionsausschuss [von Naumburg] hat einwandfrei festgestellt, dass zu solchen Massnahmen [der Reichswehr] absolut kein Grund vorlag, denn es waren meist Leute, welche die Neugier herausgetrieben hatte und sich ruhig verhielten." (Mitteilungsblatt No.1, 17. März 1920) Eine militärische oder physische Bedrohung der Jäger lag nicht vor. So gesehen, schoss das Militär ohne zwingenden Grund.
• Der Zigeuner, Musiker und Arbeiter Theodor Krystek muss sich am 3. August 1920 vor dem Naumburger Schwurgericht wegen versuchten Mordes verantworten.
 |
|
Blick
vom Nordturm des Doms zum Steinweg (2010)
|
Ihm wird vorgeworfen vom Steinweg aus auf den Landesjäger Max Winkler geschossen zu haben, der durch die Verletzung sein Bein bis oberhalb des Knies verloren hat. Der Arbeiter gesteht den Einsatz der Waffe, behauptet aber, einen anderen getroffen zu haben. Zur Rechtfertigung des Einsatzes der Waffe gibt der Angeklagte an, dass er die neue Regierung Kapp-Lüttwitz bekämpfen wollte.
Der Vorsitzende fragt nach:
"Ja, wie sollte denn das geschehen und was hatten die Soldaten der Reichswehr damit zu tun."
Krystek antwortet:
"Die Reichswehr hatte auf die Arbeiter geschossen."
Der Vorsitzende erwidert:
"Ja, als am Dienstag versucht worden war, die Soldaten von den Pferden herunter zu reissen und ihnen die Waffen abzunehmen. Das ist nach drei Hornsignalen am Dienstag gerufen worden, den Marktplatz zu räumen."
Den Leuten blieb laut Angeklagten gar keine Zeit, den Platz zu räumen. Im weiteren Verlauf der Verhandlung sagt Zeuge Stadtverordneter Winkler (SPD) aus, dass die große Verbitterung über die Schiesserei der Reichswehr auf dem Marktplatz besonders daher komme, "weil die Arbeiterschaft annahm, die Zeit zwischen der Aufforderung den Platz zu räumen und dem Schiessen sei zu kurz gewesen." (Krystek-Prozess)
• Das Blutbad wäre also vermeidbar gewesen, wenn sich die Soldaten "nicht so aufreizend benommen hätten", schätzt der SPD-Stadtverordnete Robert Manthey das Geschehene ein. (Vgl. Widerhall)
• Das Rathaus setzte der Oberbürgermeister in "unnötiger Weise in den Kriegszustand". (Manthey, SPD)
• Vom Aufzug der Truppe musste Arthur Dietrich zumindest abraten, was er aber unterlässt, und deshalb entscheidende Mitverantwortung für den blutigen Dienstag trägt.
Es ist eine Schmach, dass derartig mit Schuld beladene Personen noch auf freien Fuss und in Amt und Würden sitzen,
|
urteilt die Volksstimme (Halle) am 13. April 1920 und fordert: "Die hiesige Arbeiterschaft wird und muss dazu kommen, diesen Mann zu entfernen, wenn er nicht selbst so viel Taktgefühl besitzt, von selbst zu verschwinden." Die vorherrschende deutschnationale Stimmung und das politische Kräfteverhältnis konstituiert eine andere Wahrnehmungsperspektive, die von Bolschewismus-Angst und bewaffneten Aufstand der übermächtigen Spartakisten geprägt ist.
• Nach Eugen Wallbaum dirigiert Oberbürgermeister Arthur Dietrich die Truppen zum Rathaus. Eine andere Nachricht besagt, dass der Kommandeur der Naumburger Einheit beim Oberbürgermeister telefonisch anfragt, ob er es für zweckmässig hält, beziehungsweise ob er etwas dagegen hat, dass Militär durch Naumburg fahren zu lassen. Nach Selbstauskunft will Arthur Dietrich mit dem Aufmarsch der Reichswehr deeskalierend wirken. Von der Volksstimme (Halle) fühlt er sich zu Unrecht angegriffen und stellt deshalb am 12. Mai 1920 beim Staatsanwalt in Halle gegen die Redaktion Strafanzeige. Arthur Dietrich weist alle Vorwürfe zurück und besteht in der Stadtverordnetenversammlung am 20. April darauf, dass er den Boden der Verfassung nicht verlassen hat. Würde sich dies bestätigen, dann könnte es die Akzente bei der Deutung seines Verhaltens in den Krisentagen deutlich verschieben. Allerdings stehen die Chancen dafür nicht gut, solange eine öffentliche Erklärung von ihm gegen Kapp vor dem 18. März nicht auffindbar, also wahrscheinlich nicht abgegeben wurde. Anders zum Beispiel in der Stadt Lübeck. Hier bekundet der Senat am 13. März gegenüber der Bürgerschaftsversammlung, "dass er es für seine Pflicht gegenüber dem Reiche und der Vaterstadt ansehe, die verfassungsmäßige Regierung zu stützen." Ein derartiges Dokument ist bis heute von Naumburg nicht bekannt.
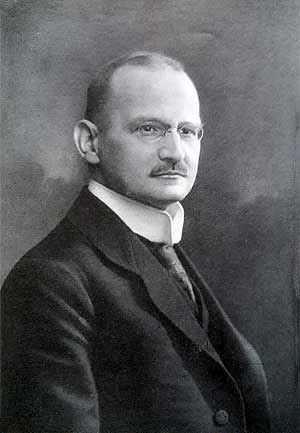 |
|
Arthur
Dietrich (1875-1932) wurde am 21. August 1912 zum Ersten Bürgermeister
der Stadt Naumburg gewählt. Das Foto entstand etwa 1920. Der
Fotograf ist unbekannt.
|
• Als Beamten dürfte Arthur Dietrich klar gewesen sein, wenn er sich irgendwie gegen die rechtmäßige Regierung wendet, dann bedeutet dies den Bruch des Amtseids und damit das Ende seiner Karriere. So gesehen stellt die Truppenparade ein geschicktes Taktieren dar. Beruhigt sich die Lage, ist es gut. Tritt das Gegenteil ein, ist er nicht schuld, denn angefordert hat er die Truppen nicht. In keinem Fall ist hier zu erkennen, wie er aktiv die Konfrontation zwischen Aktionsausschuss, Bürgern und Militär zu verhindern versucht. Als Krisenmanager der Stadt versagte der Oberbürgermeister gründlich.
• Justizrat Ludwig Wallach (Charlottenstraße 1)
schätzt vor der Stadtverordnetenversammlung am 20. April 1920
ein, „dass ein Teil der Schuld daher rührt, dass wir alle uns
viel von einem Misstrauen leiten ließen, welches uns dahin brachte,
im politischen Gegner einen schlechten Menschen zu sehen“ (Widerhall).
Auf dem Hintergrund der Ereignisse kann man das so lesen, dass Arthur
Dietrich der Annahme oder gar der Überzeugung war, der Aktionsausschuss
treibe den Generalstreik bis zum Umsturz voran. Dies könnte ein anderes
Licht auf seine Handlungsweise werfen.
17. März, Mittwoch zurück
Berlin. Selbst in militärischen Kreisen, der Reichsbank und Administration erhält Kapp nicht die erwartete Unterstützung. Der Putschversuch gilt als gescheitert.
Am Tag darauf verkündet der Chef des Truppenamtes General Hans von Seeckt in einem Fernschreiben an die Reichswehrkommandos: "Alle Befehle des Generallandschaftsdirektors Kapp und seines militärischen Oberbefehlshabers, General von Lüttwitz" für ungültig. In einem weiteren Erlass vom gleichen Tag warnt er davor, dass "Spartakus aufs Neue die Herrschaft in Deutschland an sich reißen" könnte. Deshalb muss die Reichswehr "jeden Versuch zur Aufrichtung des Bolschewismus" zurückweisen. Bedenkt man die Mentalität der Militärs, worauf Albert Grzesinski (2001, 145) aufmerksam macht, war damit ebenso die sozialdemokratische Arbeiterschaft gemeint.
Reichspräsident Ebert und die Reichsregierung rufen dazu auf den Generalstreik zu beenden. Die Verschwörer, Kapp, Lüttwitz, Ehrhardt, Jagow, Pabst, Max Bauer, Georg Wilhelm Schiele (Naumburg) und Traub sollen bestraft werden. Indessen ging die Reichswehr auch ohne Kapp und Lüttwitz weiter gegen die Arbeiter vor.
Halle. Garnisonsältester Oberst Czettritz beteuert in einer Bekanntmachung, dass die Truppen von General Maercker (Reichswehrbrigade XXVI) hinter der Regierung Ebert stehen.
An diesem Abend erscheinen Richard Krüger, Doktor Schreiber und der Abgeordnete Dietrich beim Garnisonskommando. Auf Basis der Weimarer Verfassung wollen sie die Einigung der kämpfenden Parteien erreichen. Aber, beim Garnisonskommando soll eine beratende Kommission aus Vertretern aller Parteien installiert werden und Oberst Czettritz soll zurücktreten. Die unmittelbare Reaktion darauf ist nicht bekannt. Möglicherweise geht das Garnisonskommando weiter davon aus, dass die Arbeitergarden eine Räterepublik errichten wollen.
So unmöglich wie es uns das heute erscheint, war es auch wieder nicht, wenn der von Carl Legien (ADGB) nach Rücktritt von Wolfgang Kapp am 17. März unterbreitete Vorschlag zur Bildung einer Arbeiterregierung unter Beteiligung von USPD und KPD Wirklichkeit geworden wäre. USPD und KPD waren dazu aber nicht bereit. Crispien und Däumig verweigerten sich einer gemeinsamen Regierung mit den "Arbeiterverrätern". Koenen und Hilferding wollten über eine gemeinsame Regierungsbildung verhandeln. Die USPD lehnt endgültig ab. Eine historische Chance war vergeben. (Vgl. Krause 1975, 170f.)
Merseburg. Reichskommissar und Oberpräsident Otto Hörsing (1874-1937) ernennt den mehrheitssozialistischen Landtagsabgeordneten Richard Krüger (SPD) zum Bezirkskommissar von Merseburg, der noch am selben Tag an das Garnisonskommando in Halle telegraphiert, dass Reichswehr, Zeitfreiwillige und Einwohnerwehr verpflichtet sind, zur Regierung zu halten. Wer sich weigert, ist zu entwaffnen und zu entlassen. Krüger schlägt eine forsche Gangart an.
Zeitz. Arbeiter / Bürger versperren am Morgen vor der Gaststätte Zum roten Löwen, Ecke Naumburger Straße - Donaliesstrasse, eine aus der Moritzburg (Zeitz) kommenden Armeestreife den Weg. Das Kommando von Leutnant Kunze wurde nach einem kurzen Geplänkel verhaftet. Der Leutnant soll noch "Zu den Waffen!" gerufen haben, ein Schuss fiel und seine Flucht in ein Hausflur wurde vereitelt. Der Durchbruchversuch mit dem Personenkraftwagen scheiterte. Vom Kommando, 3 Unteroffiziere und 4 Soldaten, wurde nur Leutnant Kunze und sein Begleiter Oberjäger Schulte, als Geiseln festgehalten. Die Waffen des Militärkommandos bringen die Akteure in die Räume des Volksboten und dann in das Gebäude der heutigen Geschwister-Scholl-Schule.
Es marschierten Truppen von Meuselwitz ein, meldet die Leipziger Volkszeitung am 18. März.
Schnell organisiert sich in der Stadt eine Arbeiterwehr. Sie verfügt über 3 000 bis 4 000 Gewehre, konfisziert auf Gutshöfen und bei Grossbauern, herbeigebracht aus den Waffenverstecken in den umliegenden Orten, Bergisdorf, Breitenbach, Gleina, Golben und anderen. In der Arbeiterwehr übernehmen Walter Gaudes, Richard Kehl und Otto Schuhmann eine wichtige Rolle.
Gegen 11 Uhr setzt ein heftiger Schusswechsel ein. zurück Die Arbeiterwehr hatte die Reichswehr auf der Moritzburg umzingelt. Einige ihrer Schützen finden in den oberen Etagen der Mädchenschule eine günstige Schussposition. Bei einem Ausfallversuch verlieren vier Soldaten ihr Leben.
Von einem Schuss getroffen, bricht eine junge Frau in ihrer Wohnung zusammen (Leopoldt 150).
|
Um 13.00 Uhr wir das Feuer eingestellt. Arbeiter- und Reichswehr beginnen Gespräche. Für den Aktionsausschuss verhandelt Albert Bergholz, Redakteur beim Volksboten in Zeitz. Bald erzielen die verhandelnden Parteien folgende Übereinkunft:
1. Um 14 Uhr tritt der Waffenstillstand in Kraft.
2. Die Parteien agieren in den Verhandlungen politisch neutral.
3. Das Resultat der Verhandlungen darf niemanden in der Ehre verletzen.
4. Die Verhandlungen müssen in menschenwürdiger Form ablaufen.
5. Hinsichtlich der Ehre gilt keiner als Geschlagen. (Nach Zeitzer 213)
Über die Vereinbarung stimmt die Mannschaft auf der Moritzburg ab und votiert für die Niederlegung der Waffen. Inzwischen unterrichtet Albert Bergholz in einer öffentlichen Versammlung auf dem Schützenplatz die Bürger über die Abmachungen: Abgabe der Waffen, anschliessend freier Abzug der Truppen und Übergabe der Moritzburg (Zeitz) an die Arbeiterwehr. So kommt es, die Arbeiterwehr übernimmt die Moritzburg. Hier verhandeln Aktionsausschuss und Reichswehr weiter über die Zerstörung der Waffen und die Freilassung der in Schutzhaft befindlichen Personen. Hinzugezogen werden der festgesetzte Leutnant Kunze und der Oberjäger Schulte. Anschließend werden erneut die Bürger auf dem Schützenplatz darüber unterrichtet.
"Der Aktionsausschuss Zeitz befasst sich mit Plänen über weitere bewaffnete Unternehmungen gegen die Kappisten in Halle, Leipzig und anderen Städten. Die Arbeiter legen die Waffen [in Zeitz] nicht aus der Hand. Es wurden Kraftfahrzeuge sichergestellt und Waffen bereitgehalten." (Zeitzer 1959/60, 214)
In den Morgenstunden des nächsten Tages verlässt die Reichswehr ohne Waffen die Moritzburg, um ihren Standort nach Altenburg zu verlegen. 1960 behauptet die Schrift März 1920:
"Der freie Abzug des geschlagenen Truppenteils schuf die Möglichkeit für die Reaktion, diese Soldaten an anderer Stelle wieder gegen die Arbeiterschaft einzusetzen." (Wsf 26f.)
Das ist zutreffend, weil die dortige Einheit auf Seiten der gewählten Regierung steht.
Albert Bergholz war eine politische Lösung des Konflikts wichtiger als ein militärischer Tageserfolg. Er war kein Hasenherz. Als Versammlungsredner der USPD attackiert er scharf den Einsatz der Reichswehr gegen die Arbeiter. Als Redakteur des Volksboten (Zeitz) erhebt er mutig die Stimme gegen die Naumburger Klassenjustiz. Nur Leben, die will er der Politik nicht opfern! Den Soldaten und Offizieren auf der Moritzburg (Zeitz) begegnet der gelernte Zigarrenmacher mit Achtung und Menschlichkeit. Gemeinsam mit dem Verhandlungspartner verhindert Albert Bergholz unter den Arbeitern und Soldaten weitere Tote und Verletzte. Trotzdem erhebt man Jahrzehnte später gegen ihn schwere politische Vorwürfe. 1960 (212) beanstandet ein Autorenkollektiv vom Franz-Mehring-Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig, Abteilung Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung:
"Der Zeitzer Volksbote und sein Redakteur Bergholz sowie der Geschäftsführer Leopoldt bremsten die Kampfstimmung durch Ermahnung zu Ruhe und Besonnenheit, und auch der Magistrat war bemüht, jeden Zusammenstoß zu vermeiden."
Diese Aussage wird weiter unten im Kapitel "Waffenstillstand oder Fortsetzung des Kampfes?" überprüft.
Weißenfels. zurück Der Naumburger Aktionsausschuss fordert von Weißenfels Unterstützung an. Daraufhin bringt eine Gruppe mit 30 Kämpfern ein Maschinengewehr am südöstlichen Stadtrand in Stellung. Ausserdem zirkulieren Gerüchte über eine weitere Verstärkung und Unterstützung aus Hohenmölsen, Osterfeld und Mücheln. Oberbürgermeister, Einwohnerwehr und Kreisrat Max Jüttner fürchten die Kooperation der Arbeiter und ihrer bewaffneten Abteilungen.
Naumburg. "Es herrscht Ruhe", stellt Oberbürgermeister Arthur Dietrich am 9. April 1920 in seiner Rückschau fest, "die von der Arbeiterschaft zur Agitation und zur Bewaffnung benutzt wird."
"Das Schiessen auf dem Marktplatze habe eine große Verbitterung hervorgerufen ….", stellt der gemässigte Mehrheitssozialist und Stadtverordnete August Winkler (SPD) als Zeuge im Prozess gegen Theodor Krystek am 3. August 1920 vor dem Schwurgericht in Naumburg fest.
Von der Reichswehr bekam Bäcker Hans Franke aus der Moritzstrasse am Freitag, den 19. März, ein Gewehr mit 75 Schuss abgenommen. Vorher patrouillierte er damit in der Neustraße, in Flemmingen und im Bürgergarten. Am 15. Juli 1920 muss er sich wegen unbefugten Waffenbesitzes vor der Strafkammer des Landgerichts Naumburg verantworten. Während der Verhandlung fragt ihn der Vorsitzende, ob er geschossen hätte, wenn er auf Soldaten getroffen wäre. Nur wenn sie uns angegriffen hätten, antwortete er. Darauf der Vorsitzende: Hielten sie sich berechtigt auf Menschen zu schiessen, die ihnen nichts getan haben? Franke soll entgegnet haben, dass die Truppen am Dienstag auf dem Markt von Naumburg ebenfalls auf Unschuldige geschossen haben. Der Richter wandte ein, die können sich doch nicht entwaffnen lassen. Vom Rathaus wurde gesehen, dass sie vom Pferde gezogen werden sollten. Davon hat er nichts mitbekommen, erwidert der Angeklagte. Wohl vernahm er die Trompetensignale zur Räumung des Platzes. Andere hörten sie aber nicht, fügte er an. Wir wussten aber, gab er weiter Auskunft, dass die Truppen auf Seiten von Kapp-Lüttwitz standen.
Am Mittwoch (17.3.) und Donnerstag (18.3.) organisieren die Kapp- und Reichswehr-Gegner die Selbstbewaffnung. Darüber berichtet 30 Jahre später Eugen Wallbaum (SPD): "Auf Grund dieser Vorkommnisse beschloss das Aktionskomitee die Bewaffnung der Naumburger Arbeiterschaft, welche in der darauf folgenden Nacht durchgeführt wurde. Die Waffen wurden aus den Dörfern geholt und so die Naumburger Arbeiterschaft kampffähig gemacht. Es wurden Verbindungen zu den Arbeitern von Mücheln, Zeitz und Weißenfels aufgenommen …“
"Planmäßig wurden", ermittelte der Staatsanwalt in Naumburg (9.4.1920),
"die Einwohnerwehren in den Ortschaften
der Umgebung [von Naumburg] entwaffnet und die so erlangten Waffen an die Arbeiter verteilt."
Manchmal kam es bei der Requirierung zu Auseinandersetzungen. Viele gaben, wie Fieker im Gefängnisbrief (1920) mitteilt, die Waffen freiwillig und gerne an die Arbeiter ab. Ganz so harmlos wie er das Unterfangen darstellt, war es dann doch nicht, zumindest nicht immer. In Poserna, heute ein Ortsteil von Lützen, elf Kilometer von Weißenfels entfernt, tötet am 18. März der Fabrikarbeiter Paul Maurer aus Taucha während einer solchen Aktion Siegfried Bothe. Nach Adolf Leopoldt (1931,153) hat der "Gutsbesitzer zuerst auf den Arbeiter geschossen". Zuvor soll er viele Gewehre zerschlagen haben, um sie den Arbeitern vorzuenthalten. Davon fühlte sich der Täter, vom Gemeindevorsteher damit beauftragt die Gewehre der Einwohnerwehr einzusammeln, provoziert. Am 7. August 1920 wird Paul Maurer vom Sondergericht Naumburg zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt.
Woher kamen eigentlich die Waffen? "Die Waffen [der Arbeiter] stammen wahrscheinlich im Wesentlichen von den Einwohnerwehren des Landes ...", erteilt Oberbürgermeister Dietrich im April 1920 Auskunft. Der Kreisrat für die Einwohnerwehren Naumburg Stadt, Naumburg Land und Eckartsberga Max Jüttner rüstete seine Stützpunkte 1919/20 mit Waffen aus, um im Fall der Fälle, die renitenten Arbeiter zur Räson zu bringen. Ohne diese Vorarbeit, so will es die Pointe, wären die Kapp- und Reichswehr-Gegner in Kürze der Zeit nicht an die Waffen gelangt.
"Nach meinen Schätzungen", packt Walter Fieker (Naumburg) am 20. März 1920 im Verhör mit Staatsanwalt Hardt aus, "hatte die Naumburger Arbeiterwehr ca. 60 Gewehre und ein Maschinengewehr. Es ist aber möglich, dass die Arbeiterschaft sich weitere Gewehre aus den Entwaffnungen der Einwohnerwehr verschafft hat." Und das war ganz sicher so.
Der Führer der Militäraktion Bad Kösen (19.3.) Walter Fieker gibt in der Vernehmung durch Staatsanwalt Hardt zu Protokoll, dass die Bewaffnung der Arbeiter auf Geheiss einer Verfügung des Reichswirtschaftsministers Robert Schmidt (1864-1943) vom 18. März erfolgte. Sie war den Naumburgern vom Aktionsausschuss in Halle zugeleitet worden. Nehmen wir an, diese Aussage erfolgt wahrheitsgemäss, dann bleibt immer noch der Fakt, dass die Selbstbewaffnung der Arbeiter bereits am 17. März begann. Folglich kann die Schmidt`sche Verfügung diese Aktion nicht hinreichend erklären. Insofern es diese Verfügung wirklich gab, könnte sie Walter Fieker entlasten, da er erst am 19. März mit Waffen in Aktion tritt.
Die schätzungsweise
200 Kämpfer des Aktionsausschusses
kommen von den umliegenden Orten zurück. Die akquirierten Waffen wurden - steht heute fest - im Goldenen Hahn und Fuchsbau in der Schulstrasse, früher eine Gaststätte, jetzt ein Lebensmittelgeschäft, gelagert.
|
Johannes Kegel, Führer der Einwohnerwehr Abteilung I T, informiert darüber den Naumburger Wehrausschuss (Jüttner, Dietrich):
"Am Mittwoch und Donnerstag standen fortgesetzt Gruppen von Menschen vor dem Gasthaus zum Goldenen Hahn, in dem [der] Aktionsausschuss tagte, im Gasthaus herrschte mit ununterbrochenen Gehen und Kommen Hochbetrieb bis spät in die Nacht. Am Donnerstag wurden abends die Kandelaber [Laternen], die, um den Betrieb vor dem Goldenen Hahn beobachten zu können, angezündet waren, von den Arbeitern ausgelöscht, und von der Wenzelspromenade her kamen in einzelnen Gruppen Leute mit Gewehren, die der Führer von I T an sich vorbeigehen liess und auf mindestens 150 Mann schätzte. Die meisten hatten zwei auch drei Gewehre. .... Am Eingang zum Goldenen Hahn standen Ordner, die die Leute mit ihren Waffen in die einzelnen Räume wiesen." (Kegel)
 |
|
Lehmgrube
von der
Richard-Lepsius-Straße (2009) |
 |
|
Lehmgrube
aus der
Gegenrichtung (2009) |
Der Aktionsausschuss verfügt schätzungsweise über 600 Handfeuerwaffen. Wie die Waffen aber sicher verwahren? In der Lehmgrube am Kalten Hügel? Oder können sie die Kämpfer mit nach Hause nehmen? Darüber kommt es zwischen Paul Heese und Walter Fieker zum Streit. Im Ergebnis ergeht kein klarer und eindeutiger Befehl. Wochen später müssen sich viele Kapp-Gegner vor Gericht wegen unbefugten Waffenbesitzes verantworten. Arbeiter Paul Hohlfeld empfängt am Abend des 18. März, also am Tag vor dem Gefecht mit der Reichswehrbrigade 16 (Landesjägerkorps), sein Gewehr im Goldenen Hahn und nimmt es mit nach Hause. Wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt ihn das Naumburger Landgericht am 15. Juli 1920 zu sechs Monaten Gefängnis. Mit derselben Begründung verhängt das gleiche Gericht am 29. Juli 1920 über den Anti-Kapp-Kämpfer Richard Kanzler aus Lengefeld (bei Bad Kösen) vier Monate Gefängnis.
Oberbürgermeister Dietrich und der Aktionsausschuss treten zu weiteren Gesprächen zusammen. Jetzt dominieren die Mehrheitssozialisten (SPD). Dietrichs Aufforderung, sie sollen doch die Institutionen der Stadt schützen, dann würden sie die bestehende Regierung unterstützen, ignoriert, was am Tag zuvor geschehen war. Der blutige Dienstag ramponierte das Vertrauen zum Oberbürgermeister bei den Republikanern, Kapp- und Reichswehr-Gegnern gründlich. Dieser Umstand findet in seinem Bericht an den Herrn Zivilkommissar für den Regierungsbezirk Merseburg vom 9. April 1920 keine Beachtung. Insoweit muss die Lageeinschätzung zum März 1920 von ihm mit Umsicht aufgenommen werden.
Osterfeld. zurück Die Darstellung der Kämpfe in der etwa 2 000 Einwohner und 17 Kilometer südöstlich von Naumburg liegenden Kleinstadt Osterfeld ist schwierig, weil sich beim Vergleich der Daten und Fakten aus den verschiedenen Quellen, selbst wenn von Bewertungen und Kommentaren soweit wie möglich abstrahiert wird, Differenzen ergeben und Anomalien auftreten. Osterfeld darf deshalb nicht vergessen werden. Fast eine Woche rangen hier die Arbeiter im Kampf mit Kapp`s Sympathisanten um den militärischen Erfolg. Das wirkte auf die Haltung des Aktionausschusses in Naumburg und darüber hinaus bis Halle (Saale) zurück.
|
Die Erinnerungen an Osterfeld stützen sich auf die hier aufgeführten sieben Informationsquellen (A, B, C, D, E, F, G). Für sie ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung und die Herkunft bekannt, was zumindest auf das Erkenntnisinteresse und die pragmatik der Texte Rückschlüsse gestattet.
"Osterfeld", heisst es 1960 in einer Studie, "war bekannt als reaktionär." Die Deutschnationale Partei und Deutsche Volkspartei hatten hier viele Anhänger. Im Bürgerausschuss bildet sich ein Block gegen die Osterfelder Arbeiterschaft. Besonders die Mitglieder der Kommunistischen Partei waren Schikanen ausgesetzt. [D 28]
Bürgermeister Jaeckel, was allseits unbestritten, steht auf der Seite der neuen Regierung [B 214]. Die Anhänger von Kapp wandten sich an die Sipo [Sicherheitspolizei] Weißenfels und erhielten zwei Tage zuvor von dort zur Unterstützung ein Kommando von 36 Mann. [D 28]
Die Arbeiter verlangten von Jaeckel die Auslieferung sämtlicher Waffen, was er verweigerte. Daraufhin sperrten ihn die "Osterfelder Genossen" in sein Amtszimmer ein und durchsuchten alle Räume. Hierbei entdeckten sie eine größere Anzahl von Gewehren und einige Maschinengewehre. Außerdem fand sich ausreichend Munition. [D 29]
Ein anderer Trupp Arbeiter durchsuchte die umliegenden Dörfer und requirierte Gewehre aus Verstecken, die ihnen zum Teil schon vorher bekannt waren. Ihre Unterbringung in Osterfeld erschien nicht sicher, weshalb sie nach Teuchern verbracht wurden. [D 29]
Noch am Abend entwickelte sich im Stadtzentrum zwischen den Anhängern und Gegnern von Kapp ein heftiger Feuerwechsel. Die Arbeiter waren zahlenmäßig zu schwach und mussten sich zurückziehen. Sie ersuchen Weißenfels um Unterstützung. [D 28+29]
18. März, Donnerstag zurück
Osterfeld. In der Nacht eilen Kämpfer aus den Arbeiterwehren in Teuchern, Stößen, Hohenmölsen und Droyssig [C 44, D 29] den Kapp-Gegnern zur Hilfe. Aus Zeitz machen sich weitere 120 Arbeiter auf den Weg. Unterwegs heben sie in Meineweh ein Waffenversteck aus. [B 215]
Erneut entbrannten heftige Kämpfe zwischen den mehr als 1 000 Arbeitern aus Osterfeld, Teuchern, Hohenmölsen, Droyssig und Zeitz einerseits [C 44] und der Bürgerwehr, Sipo Weißenfels und dem Schützen- und Kriegerverein von Osterfeld andererseits. Da die Kapp-Leute zunächst Widerstand leisteten, "schwärmten die von Zeitz aus geleiteten Arbeiter in regelrechten Schützenlinien aus und schlossen die Stadt ein." [E 88]
Durch Einleitung von Verhandlungen, unterstützt vom Gewerkschaftssekretär Joseph Windau, will Albert Bergholz (Zeitz) einen friedlichen Ausgleich der kämpfenden Parteien erreichen. Als das Gerücht aufkommt, Windau sei verhaftet worden, greifen die Arbeiter erneut an und es beginnt ein heftiger Straßenkampf. [B]
Um das Rathaus begann ein zähes Ringen. Die Bürgerwehr leistete tapferen Widerstand. Die Kapitulation erfolgte wegen Munitionsmangel [G]. Die Einwohnerwehr wurde so fast vollständig aufgerieben. [A] Es kam zu "grauenhafte(n) Bluttaten der Bolschewisten", meldete das Naumburger Tageblatt am 24. März 1920. Zunächst war freies Geleit von den Roten gegeben. "Als beim Entladen der Gewehre unbeabsichtigt sich noch ein Schuss löste, stürmten die Spartakisten in wilden Haufen in das Rathaus hinein und schlugen jeden nieder, der ihnen vor Augen kam, wobei sie selbst vor Bestialitäten an Verwundeten und Sterbenden nicht zurückschraken." [A] Etwa vierzig "Ermordete", schätzt das Naumburger Tageblatt, sind zu beklagen. [A] Darunter befinden sich sechs Kapp-Gegner. [B]
Bürgermeister Jaeckel, der an einer Lungenentzündung erkrankt, wurde viehisch ums Leben gebracht [A]. Der Erste Staatsanwalt von Naumburg spricht davon, dass ein Mann von 67 Jahren "erschlagen" wurde [G]. Das Autorenkollektiv von Zeitzer Arbeiter schlagen den Kapp-Putsch nieder [B 215] schreibt 1960: "Der verhaftete Bürgermeister [Jaeckel] als Haupturheber des Kampfes wurde auf dem Marktplatz von der erbitterten Menge ergriffen und mit einem Gewehr niedergeschlagen. Auf einem Lastkraftwagen wurde er mit den gefangenen Sicherheitspolizisten nach Zeitz gebracht, wo er unterwegs seinen Verletzungen erlag."
Helmut Böttcher schreibt 1920 in Generalstreik und Bürgerkrieg: "Besonders grausam gebärdete sich die rote Arbeiterschaft .... Als die Einwohnerwehr überwältigt war, wurde der Bürgermeister in bestialischer Weise ermordet." [E 88] Der Autor erhebt den Anspruch auf Die Wahrheit über die Ereignisse in Halle (Saale) und Mitteldeutschland, verliert aber kein Wort über die Unterstützung durch Sipo Weißenfels, die bei den Arbeitern verhasst war. Ebenso erfährt der Leser nichts über die Politik des Bürgermeisters Jaeckel und die politischen Ambitionen der Osterfelder Bürgerwehr.
Am Nachmittag des 18. März kapituliert die Sipo und Osterfelder Bürgerwehr. Sie wird entwaffnet und nach Zeitz und Teuchern abtransportiert. (F 151) Arbeiter-Kommandos führen am Abend Hausdurchsuchungen durch, wo es erneut zu blutigen Zusammenstössen kommt.
Gewerkschaftssekretär Joseph Windau soll laut Recherchen des Autorenkollektivs der Abteilung Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung vom Franz-Mehring-Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig [B 215] die Kapp-Gegner mit den Worten verabschiedet haben:
"So nun geht nach Hause,
legt Euch aufs Sofa und wartet ab, was kommt!"
Berlin. Die sozialdemokratische Reichstagfraktion ruft zur Wiederaufnahme der Arbeit auf.
Der Stellvertreter der Reichskanzlers Schiffer teilt am 17. März der Presse mit, dass "Der verfassungsmäßige Zustand wieder hergestellt!" ist. Das Wirtschaftsleben liegt danieder, weshalb das deutsche Volk aufgefordert, die Arbeit wieder auszunehmen. Am Tag darauf erscheint diese Erklärung in vielen Zeitungen. Für die Naumburger dürfte es nicht ganz einfach sein davon Kenntnis zu nehmen, denn seit Montag sind in der Stadt keine Zeitungen mehr im Angebot.
Naumburg. Das Garnisonskommandos Naumburg veröffentlicht folgende Mitteilung: [1.] Auf Anordnung der verfassungsmässigen Regierung übernimmt Generalmajor Hans von Seeckt den Befehl über die Truppen des Reichswehrkommandos I. [2.] Oberpräsident Hörsing ist zum Reichskommissar und Militäroberbefehlshaber für Sachsen und Sachsen-Anhalt ernannt worden. [3.] Die Reichswehrbrigade XVI. (Maercker) steht [jetzt] geschlossen [!] zur gewählten Regierung. Staatsanwalt Brygalski (Naumburg) verliest dieses Dokument vor dem Goldenen Hahn einer Gruppe von Arbeitern. Darauf soll der Vorsitzende des Aktionsausschusses Leopold Heinrich geantwortet haben, dass sie diese bereits kennen und sie nichts angeht, weil sie ihre Befehle von ihrer [USPD-] Bezirksleitung erhalten.
Der Naumburger Aktionsausschuss ruft zur Bildung eines "fest gefügten Block des Widerstandes" gegen Kapp auf.
|
"Am Abend [des 18. März] kehrt die sechzig Mann zählende Radfahrerkompanie des Jägerbataillons von Weimar nach Naumburg zurück. Bis dahin hatte die Besatzung der Garnison nur aus 40 Mann Artillerie mit zwei Geschützen bestanden." (Staatsanwalt) Dies verändert das militärische Kräfteverhältnis in Naumburg klar zugunsten Reichswehr. Trotzdem wollen die Kapp-Gegner gegen sie kämpfen. Der Führer der Einwohnerwehr Abteilung I T und Lehrer am Domgymnasium Johannes Kegel (geboren 1881) berichtet: "Am Donnerstag wurden Abends die Kandelaber [Ständer für Kerzen] bis spät in die Nacht, die, um den Betrieb vor den Goldenen Hahn beobachten zu können, angezündet waren, von den Arbeitern ausgelöscht, und von der Wenzelspromenade her kamen in einzelnen Gruppen Leute mit Gewehren, die der Führer von I T [Einwohnerwehr] an sich vorbeigehen liess und auf
mindestens 150 Mann
schätze. Die meisten hatten zwei auch drei Gewehre. In derselben Weise hatten auch Posten vor dem Schwurgericht geschätzt. Am Eingang zum Goldenen Hahn standen Ordner, die die Leute mit ihren Waffen in die einzelnen Räume wiesen. Kurz vor 10 Uhr abends entfernten sich die Leute aus dem Gasthofe,
man
hörte die Rufe: also
morgen früh."
So war im Goldenen Hahn wahscheinlich bereits die Entscheidung gefallen, den Kampf aufzunehmen. Denn vom Fortbestehen der konterrevolutionären Gefahr sind sie weiter überzeugt. Aber rechneten die Kapp-Gegner mit Rückkehr der Truppen aus Weimar? Das ist nicht eindeutig zu beantworten.
Bad Kösen. zurück Im Februar / März 1919 streikten die Arbeiter. Das missfiel dem Kösener-Bürgertum und es gründet am 7. März 1919 die Einwohnerwehr. "Diese ist gebildet worden," erläutert ihr Aufruf vom 18. August 1919, "um das Leben und das Eigentum der Bürger gegen Bedrohung, Erpressung, Diebstahl, Raub, und Plünderung zu schützen." 76 Bürger schrieben sich sofort als Mitglieder ein. "Das Bezirkskommando in Naumburg wurde angewiesen für die Bewaffnung 120 bis 150 Mann der Bürgerwehr mit Gewehren und 3 leichten MG zu sorgen." Tischler Neumann, der Eisenbahner Martin und Zimmermanm Töpfer wurden zu Vorstandsmitglieder gewählt." (Budde)
Zur Finanzierung erfolgt ein Spendenaufruf an die Bürger. Die USPD verlangt am 18. März, dass die Hälfte der Mitglieder Arbeiter sein sollen. Zahlungskräftige Bürger stellen erhebliche Geldmittel zur Verfügung. (Vgl. Budde) In den Kapp-Tagen übernehmen Hauptmann Kaufmann Siebold und Gustav Unruh, seit 31. Juli 1915 Eigentümer der Burg-Apotheke, die Leitung der Bürgerwehr. Wie in Naumburg, besass sie Waffen und stand auf der Seite von Kapp-Lüttwitz.
 |
|
Bad
Kösen um 1930
(Postkartenausschnitt) |
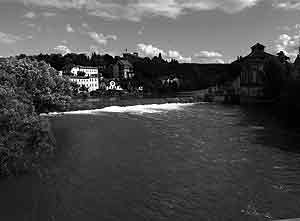 |
|
Blick
von der "Brücke der Einheit"
über die Saale in Bad Kösen (2013) |
Die Waffen lagen, behauptet Hermann Firchau (1894-1976), "ausschliesslich in den Händen der reaktionären Bürgerwehr". Adolf Schuster aus Almrich streift am 17. und 18. März mit etwa 100 Naumburgern und einigen Kösenern über die umliegenden Orte und entwaffnet Bauern. Als die Bürgerwehr von dieser Aktion der USPD-Leute und Spartakisten hörte, mobilisiert sie ihre Mannen zum Schutz der Stadt. Was lag näher, als die Roten bei ihrer Rückkehr am Stadtrand abzufangen. So bezogen etwa 200 Mann (Firchau) am Holzwerk Position. Zum Kampf kommt es nicht. Hermann Firchau erzählt: "An der Stadtgrenze Bad Kösens hatte sich die Bürgerwehr - etwa 200 Mann - hinter den Langholz und Bretterstapeln des Dampf-Sägewerkes ...., festgesetzt. Die bewaffnete Gruppe [von Adolf Schuster] schwärmte aus und kreiste das Dampf-Sägewerk ein." "Die Bürgerwehr wurde restlos entwaffnet, ohne dass dabei ein Schuss fiel. Die Führung der Bürgerwehr lag in den Händen des ehemaligen Hauptmanns Siebold. Er erklärte sich zu Verhandlungen bereit."
Hauptmann Siebold "....gab den restlichen Bürgerwehrgruppen, die sich in Höhe der Eckartsbergaer Strasse bewegten, Anweisung, sich mit Waffen in das Rathaus zu begeben. Der Widerstand einzelner wurde gebrochen, sie wurden nach dem Rathaus geführt. Als die Bürgerwehr vollzählig vor dem Rathaus versammelt war, wurden sie vollkommen eingekesselt. Unter dem Druck der bewaffneten Arbeiter erklärte sich Siebold zu Verhandlungen über die Waffenfrage bereit." (Firchau)
Bei den Verhandlungen im Rathaus sind die Arbeiter Adolf Schuster (Almrich), Hugo Voigt (Bad Kösen), Hermann Firchau (Lengefeld) und Hermann Patze (Bad Kösen) zugegen. Von Seiten der Bürgerwehr nehmen Siebold, Unruh (Apotheker) und noch zwei andere Bürger teil. Mindestens die Hälfte der Bürgerwehr, soll aus USPD-Mitgliedern bestehen, fordern die Arbeiter. Andernfalls, kündigen sie an, wird die Versorgung mit Lebensmitteln, Licht und Wasser sabotiert. Die Bürgerwehr ist empört und reagiert heftig. Adolf Schuster durfte an den weiteren Verhandlungen nicht weiter teilnehmen.
"Die Verhandlungen endeten mit einem Kompromiss," rekapituliert Hermann Firchau (Bad Kösen / Lengefeld), "wonach die Waffen im Rathaus zu hinterlegen waren, und zwar unter ständiger Bewachung je eines Postens der Arbeiter und der Bürgerwehr. Unter den Wachposten der Arbeiter befand sich ein gemeiner Verräter, namens Otto. Er machte mit dem Posten der Bürgerwehr gemeinsame Sache, in dem sie sämtliche Gewehrschlösser entfernten und die Waffen dadurch unbrauchbar machten."
Albert Bergholz (Zeitz) brandmarkt am 5. Mai 1920 auf der USPD-Versammlung in Naumburg
"die Kösener Vorgänge .... als ein Verrat eines Köseners Schmiedemeisters und als eine grausame Handlung [per]vertierter Noskiden".
Als Hermann Firchau und Hugo Voigt am Vormittag [des 19.3.] Die unbrauchbaren Gewehre entdecken, unterrichten sie sofort ihre Genossen. Umgehend berufen sie in die Gastwirtschaft Zur Tanne eine Versammlung ein. zurück
Über die Ereignisse in Bad Kösen existieren vier Erzählungen. Eine verfasst der Arbeiterveteran Hermann Firchau (1894-1976) aus Lengefeld bei Bad Kösen, der aktiv an den Kämpfen teilnahm.
Eine zweite Erzählung entstand 1920 mit Helmut Böttchers Schrift:
Kapp-Lüttwitz-Putsch. Generalstreik und Bürgerkrieg. Die Wahrheit über die Ereignisse in Halle (Saale) und Mitteldeutschland.
Der Hauptschriftleiter der Halleschen Zeitung kapriziert sich auf die Story vom kommunistischen Putsch. Die Pflege dieses Monuments deutschnationaler Geschichtsschreibung übernehmen nahtlos die Nationalsozialisten.
Während sich der Sozialist (Wallbaum), Unabhängige (Firchau), Kommunist (Fieker) und DDR-Historiker (Kormann) dem November 1918 verpflichtet fühlen, bricht die NSDAP-Story radikal mit dieser demokratischen Tradition. "… wir waren dazu bestimmt, diese Schmach [aus jenen Novembertagen 1918] zu löschen", erklärt Friedrich Uebelhoer, NSDAP-Kreisleiter und Oberbürgermeister der Stadt Naumburg den Teilnehmern der Denkmalsweihe für die Gefallenen der ehemaligen Einwohnerwehr und des Landesjägerkorps am 28. April 1935 in Naumburg.
Etwa 30 Jahre später legt Gottfried Kormann mit seinen regionalgeschichtlichen Aufsätzen den Gegenentwurf vor. Sie handeln vom (Klassen-) Kampf der Arbeiter gegen die Reichs- und Bürgerwehr, dem Verrat der rechten SPD-Führung an den Kapp-Gegnern und sind Auftakt zu neuen grossen Aktionen. Diese dritte Erzählung über die Ereignisse in Bad Kösen und die Tanne stützt sich auf verschiedene Berichte der Akteure, speziell von Hermann Firchau.
Eine vierte Erzählung stammt von Eugen Wallbaum. Die Analyse der Stadt Naumburg berichtet um 1950 für interne Kreise im Einklang mit den wichtigsten Fakten und ideologisch deutlich unaufgeregter über die Geschehnisse im März 1920.
Bei Kormann und Wallbaum fehlen alle Hinweise zu den Aktivitäten der Gruppe Fieker, die am 19. März von Naumburg nach Bad Kösen marschierte und dort an Versammlung in der Tanne teilnimmt. In den 20er Jahren vertritt Walter Fieker die KPD im Naumburger Gemeinderat. Anfang der 50er Jahre gilt er als Verräter. Möglicherweise meiden ihn deshalb die Erzähler. Seine Darstellung der Ereignisse in der Vernehmung durch Staatsanwalt Hardt (Naumburg) und im Gefängnisbrief vom 25. April 1920 sind für die Forschung eine wertvolle Quelle.
19. März, Freitag zurück
Halle. Oberst Czettritz, Garnisonsältester, warnt unter der Losung "Vergesst in Halle den Streit um alte und neue Regierung!" vor der "drohenden Bolschewistengefahr" und fordert:
"Tretet ein als Zeitfreiwillige.
Erscheint zur Einwohnerwehr!"
Anstatt den demokratischen Dialog aller politischen Kräfte gegen Kapp-Lüttwitz zu fördern, heizt es die Atmosphäre weiter auf. In der Burgstrasse (Ecke Steiler Berg) geraten Unterstützer und Gegner des Putsches heftig aneinander.
Gegen die im am Südrand der Stadt kämpfenden Arbeiter rückt das I. Bataillon des 31. Infanterieregiments aus Merseburg heran. Um die Mittagszeit gelingt es den Arbeitern zusammen mit russischen Kriegsgefangenen aus dem Lager Merseburg, sie zwischen Döllnitz und Osendorf aufzuhalten. "Ermutigt durch diese Erfolge und den anhaltenden Abwehrkampf, vervielfachten die Arbeiter Halles ihre Aktionen und entwaffneten in der Reilstrasse, am Markt, am Steinweg und in anderen Teilen der Stadt gegnerische Kräfte …". (Dreetz 175)
Diese Lageentwicklung beeinflusste wahrscheinlich die Entscheidungen der Reichswehrkommandeure in Naumburg.
 |
|
Blick
auf Weißenfels (2012)
|
Weißenfels. zurück Eine Gruppe von Kapp-Gegnern riegelt die Einfahrtsstrasse aus Richtung Naumburg ab und installiert auf der Brücke über der Eisenbahnlinie Naumburg-Weißenfels ein Maschinengewehr. Andere beschlagnahmen die Ladung eines Brottransporters, worüber drei Wochen später Oberbürgermeister Dietrich (Naumburg) berichtet: "Ein städtisches Auto, das beauftragt war, Brot in Weißenfels für die hiesige Batterie [in Naumburg] abzuholen, wird dort angehalten. Das Brot wird vom Aktionsausschuss beschlagnahmt, der Chauffeur wird unter Androhung des Erschießens gezwungen, 30 bewaffnete Weißenfelser mit 12 Maschinengewehren nach Naumburg mitzunehmen, die im Leuschholz, einem benachbarten Hügel im Südosten Naumburgs in Stellung gebracht werden."
Naumburg. In den Abendstunden gewinnt die Reichswehr die Handlungshoheit zurück. Drei Tage später vereinbaren Stadtverwaltung und Reichswehr, dass die Brottransporte für die Garnison sofort wieder einsetzen müssen. Ausserdem sollen die Verantwortlichen für die entwendeten 1 200 Brote Schadensersatz zahlen.
|
Übersicht
zu den Ereignissen
am 19. März 1920 in Naumburg (Saale) |
 |
|
Karte
- groß
|
Naumburg. zurück Rote Plakate des Militärbefehlshaber Major Wiesner verkünden in Naumburg den verschärften Ausnahmezustand für die Stadt und Ortschaften im Umkreis von 20 Kilometer, fordern die Abgabe der Waffen bis 20. März 9 Uhr und verbieten Versammlungen unter freien Himmel sowie das Erscheinen des Mitteilungsblattes des Aktionsausschusses. Die Einwohnerwehr soll ihre Waffen in der Jägerkaserne zurückgeben.
Mitglieder des Aktionsausschusses wenden sich an die Streikleitung in Weißenfels, Mücheln, Zeitz, Eisenberg und Schkölen um Hilfe (vgl. Wsf 31).
Lehmgrube, Naumburg, 9 Uhr früh. Auf dem Schützenplatz steht ein Trupp bewaffneter Arbeiter zusammen. zurück Ihr Anführer heisst Walter Fieker. Im letzten Krieg diente er ab 4. August 1914 beim Gardefeldartillerieregiment. Geschlagen von einer Lungenerkrankung, kehrte er nach drei Jahren mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse an der Brust nach Hause zurück. Vor knapp einem Jahr heiratete er.
Zunächst besprechen sie die militärische Lage. Dann brechen sie nach Bad Kösen auf. Die Entscheidung über diese Aktion fiel wahrscheinlich am Tag zuvor im Goldenen Hahn. Bereits kurz nach dem Abmarsch geraten sie auf der Jenaer Strasse unter Beschuss.
Ein Mitglied der Gruppe Fieker erzählt:
"Wir waren in der Lehmgrube zirka 40 bis 50 Mann. Da die Lehmgrube kein sicherer Fleck war, verließen wir sie und sind rüber nach der Jenaer Strasse. Dort wurden wir unter Feuer genommen. Wir hatten uns in Gruppen verteilt und wollten das Feuer erwidern. Unser Maschinengewehr hatte Ladehemmung. Das Feuer verstärkte sich. Genosse Fieker gab das Kommando: Ausschwärmen. Wir verteilten uns unter Beschuss auf die Felder. So kamen wir bis an die Holländer Mühle. Verluste hatten wir nicht. Wir sammelten uns am Sperlingsholz.
Wir sind dann über die Windlücke nach dem Gradierwerk von Bad Kösen gelaufen. Dort haben wir uns formiert. Mit dem Gesang der Internationale marschierten wir in Bad Kösen ein. Wir gingen in die Tanne. Das Arbeiterlokal. Dort verweilten wir im Hof und stellten Posten auf ...." (Kurt Dittmar)
In der Vernehmung durch Staatsanwalt Hardt (Naumburg) am 20. März 1920 gibt Walter Fieker folgende Darstellung:
"Während wir noch damit beschäftigt waren den jüngeren unerfahrenen Leute, die Waffen abzunehmen, ertönte der Ruf: Wir werden umzingelt. Da stürmten ca. 20-25 Mann fort und legten sich in Deckung." Paul Heese war dabei und sagte:
Wir lassen uns nicht in die Flucht schlagen. Entweder verteidigen wir uns, oder wir schlagen die Waffen kaputt."
"Jetzt kam ein unbekannter Bote aus der Arbeitermasse", erzählt Fieker weiter, "die sich beim Seminar angesammelt hatte und sagte: Seht euch vor, am Seminar stehen Maschinengewehre. Die Leute setzten sich in Bewegung, Richtung Schrebergärten und bildeten Schützenketten und das Gefecht begann. Die ersten Schüsse fielen von der Brauerei und vom [Lehrer-] Seminar her."
Walter Fieker beendet das Meeting mit dem Hinweis: Wer nicht mitgehen will, lässt sein Waffen stehen und kann nach Hause gehen.
Vierzig bis fünfzig bewaffnete Männer marschieren vom Schützenplatz zur Holländer Mühle. Von dort in Richtung Flemmingen, weiter über den Knabenberg zur Windlücke zwischen Schulpforta und Bad Kösen (Daten, Karte). zurück Unterwegs streifen sie das Gebiet um den Bismarck-Turm. Laut offizieller Meldung findet hier der Obersekundaner Fricke aus Schulpforta durch eine Spartakistenpatrouille den Tod. Noch am 19. März verhaftet die Reichswehr Walter Fieker und verbringt ihn in das Gefängnis nach Naumburg. In den erhaltenen Verhörprotokollen kann man vom Fall Fricke nichts lesen. Offenbar hat die Gruppe damit nichts zu tun.
Jahrzehnte später kritisieren Kampfgenossen das Unternehmen der Gruppe Fieker, weil es zu einer Zersplitterung der Kräfte führte. Denn zum Zeitpunkt Abmarsches beginnen in Naumburg die Kämpfe zwischen den Kapp-Gegnern und der Reichswehr nebst Einwohnerwehr. Die Reichswehr erwartet aus Weimar Verstärkung. Auf ihren Weg nach Naumburg muss sie die Brücke in Bad Kösen passieren. Entlang der Strasse von Bad Kösen nach Naumburg erheben sich auf beiden Seiten Höhenzüge, die im Fall der Fälle geschickt zur Verteidigung oder zum Angriff gegen die Reichswehr und Zeitfreiwilligen genutzt werden könnten. Eben hier auf dem Knabenberg, ein bewaldeter Höhenrücken auf der rechten Saaleseite über Schulpforta und Almrich, begegnet die Gruppe Fieker unbewaffnete Arbeiter aus Bad Kösen. In der Nähe der Kukulauer Straße operiert eine weitere Gruppe. Teile von ihnen ziehen weiter in die Tanne nach Bad Kösen.
Warum marschierte der Fieker-Trupp aus der Lehmgrube (Naumburg) nach Bad Kösen? Wollten sie die Reichswehr aufhalten? Fieker verleugnet im Verhör beim Staatsanwalt den militärischen Charakter der Bad-Kösen-Aktion. Angeblich zogen sie in das Nachbarstädtchen, um mit den Zimmerern über die Ablieferung von Streikgeldern zu sprechen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass man die Waffen holen wollte, welche in den vergangenen Tagen in den umliegenden Dörfern akquiriert wurden. So stellt es auch der Tapezierer Willi Freund (Naumburg) gegenüber Staatsanwalt Hardt (Naumburg) dar.
Merseburg / Naumburg. Etwa 200 Meter vom Goldenen Hahn entfernt liegt das Gefängnis. Normalerweise sind dort etwa 239 Personen inhaftiert. Zur Zeit der Märzunruhen sind es 550 und am 30. Juli 1921 noch 300 Personen. Immer wieder versuchen Kapp-Gegner in Abstimmung mit den Aktionsausschüssen in Naumburg und Zeitz, die Freilassung der Politischen zu erreichen. Einige Desperados, so lässt sich vermuten, hatten wahrscheinlich noch weitergehende Pläne. Jedenfalls spitzt sich Sicherheitslage um das Gefängnis zu.
Naumburg. ".... morgens gegen 9 Uhr gingen Leute [Kämpfer des Aktionsausschusses] einzeln und in Gruppen die Kamburger Strasse hinauf, mit und ohne Waffen", beobachtet der Kommandeur der Einwohnerwehr Johannes Kegel. "3 - 4 Maschinengewehre wurden im goldenen Hahn getragen. Kurz darauf schwärmten bewaffnete Arbeiter von der Kamburger Strasse aus in Richtung Sperlingshols [Sperlingsholz]. Dort wurde darauf das Feuer eröffnet."
"In den Strassen sieht man allenorts bewaffnete Arbeiter laufen", registriert Oberbürgermeister Arthur Dietrich. "Es sammeln sich grosse Banden [die Kämpfer des Aktionsausschusses] im sogenannten Birkenwäldchen, in der Kiesgrube, im Süden und Südwesten der Stadt, ausserdem in der Nähe des Goldenen Hahns, den Sitz des Aktionsausschusses (Waffenlager) und in den umliegenden Strassen. Zwei Jägerpatrouillen von je 15 Mann durchstreifen die Stadt und werden von bewaffneten Arbeitern angegriffen."
Der Erste Staatsanwalt (14.4.1920) von Naumburg dokumentiert: "Am Morgen dieses Tages um 10 Uhr begann das Gefecht zwischen den bewaffneten Arbeitern und den durch Einwohnerwehren verstärkten Reichswehrtruppen in den Strassen Naumburgs, unweit des Schwurgerichtsgebäudes."
 |
|
Blick
von der Moritzwiese zum Oberlandesgericht (2010)
|
Er vergisst nicht anzumerken: "Als ich um 10 1/2 Uhr auf dem Wege zum Schwurgerichtsgebäude von dem Vorplatze in die zum Gefängnis führende Seitenstrasse einbog, fiel vom Goldenen Hahn her ein Schuss. Das Pfeifen der Kugel habe ich nicht gehört. Ebenso fiel ein Schuss, als sich etwa um dieselbe Zeit zwei in Uniformen befindliche Gefangenenaufseher an der nämlichen Stelle befanden." Ausserdem ist auf "die Mannschaft eines auf dem Dach des Gefängnisses postierten Maschinengewehres geschossen worden, sodass sie das Dach verlassen musste."
In der zehnten Stunden dringen Schüsse von der Lehmgrube (Schützenplatz) in die Stadt.
".... aus vielen Wohnungen und allerlei Verstecken wurden [später] Gewehre ans Licht gebracht". (Gegenrevolution)
Gegen 11 Uhr vormittags ruft der Regierungspräsident Wolf von Gersdorff (1867-1949) den Ersten Staatsanwalt in Naumburg an und informiert ihn darüber, dass bei ihm in Merseburg eben eine vierköpfige Delegation aus Zeitz eingetroffen ist, die um die sofortige Freilassung der Politischen aus dem Gefängnis in Naumburg ersucht. Es sind Untersuchungshäftlinge, die in Verbindung mit den Unruhen im März 1919 in Zeitz in Haft kamen.
Gersdorff unterstützt ihr Verlangen, verweist aber auf den zuständigen Staatsanwalt. Sogleich begeben sich Deputierten nach Naumburg.
In den Verhandlungen mit dem Staatsanwalt in Naumburg drohen sie mit dem Einsatz von Minenwerfern und Artillerie. "Mehrere tausend Mann" stehen zum Sturm bereit. Wenn die politischen Gefangenen freigelassen werden, versprechen sie, dann lassen die im Anmarsch befindlichen Truppen vom Angriff ab. Trotzdem gibt der Erste Staatsanwalt die Untersuchungshäftlinge nicht heraus. "Ich bemerkte", sagt er knapp vier Wochen später, "dass der Zweck dieses Angriffs zweifellos nicht nur die Befreiung der Zeitzer Gefangenen sei, sondern vielmehr die Einnahme der Stadt Naumburg für die in Mitteldeutschland zu begründente [laut Zitat] Räterepublik dient. Die Aufrichtung der Diktatur des Proletariats war bereits in der Nr. 63 des Zeitzer Volksboten vom 15. März 1920 proklamiert gleichzeitig mit dem Generalstreik."
 |
|
Neuengüter
(2010)
|
Um die Mittagszeit verläuft die Kampflinie vom Georgenberg - Dom - Oberlandesgericht - Moritzwiesen - Neuengüter - Michaelisstrasse - Seminargebäude - Kalter Hügel bis zur Lehmgrube.
"Bewaffnete Arbeiter lagen vor dem Oberlandesgericht über den Domplatz, die Neuen Güter bis zur Michaelisstrasse und Eckhardtstrasse, dort wurde eine Jägerpatrouille bedrängt, die sich schliesslich in ein Haus zurückzog. In der Michaelisstrasse wurden halbwüchsige Burschen festgestellt, die auf der Strasse lagen und schossen. Die Munition wurde ihnen von Frauen und Männern von den Häusern zugeworfen. Zwei Zeitfreiwillige von einer Abteilung, die den Jägern zu Hilfe geschickt war, waren erschossen." (Kegel)
 |
|
Blick
vom Nordturm des Doms (2010) in Richtung Gefechtsfeld Oberlandesgericht
- Moritzwiesen am 19. März 1920
|
Die Kämpfer des Aktionsausschusses greifen aus Richtung Moritzwiesen, Neuengüter und Steinweg an. Am Oberlandesgericht positioniert die Reichswehr Geschütze und Maschinengewehre.
"Es entsteht ein Gefecht," notiert Oberbürgermeister Dietrich in seinen Aufzeichnungen, "in das der Stosstrupp der Einwohnerwehr und schließlich sogar die Batterie mit dem Geschütz eingreifen muss, weil die gegnerische Partei ausserordentlich stark ist."
Der Erste Staatsanwalt begibt sich nach dem Anruf von Regierungspräsident Gersdorff zum Oberlandesgericht, um mit dem Kommandeur der Einwohnerwehr über die Möglichkeit der Verteidigung des Gefängnisses Rücksprache zu nehmen. Er traf Max Jüttner
"im lebhaften Feuergefecht bei der Artillerie
am Oberlandesgericht".
 |
|
Seminargebäude |
"Das beiderseitige Feuer durchschnitt in kurzen Pausen die Luft," kommentiert das Naumburger Tageblatt am 24. März im Stil der Kriegsberichterstattung, "schwoll mitunter zu grosser Heftigkeit an und wurde dann wieder schwächer."
Stundenlang dauert der Kampf um den Platz vor der Seminarstrasse. Die Kinder der Schule im Seminargebäude suchen im Keller Schutz. Hin und her tobt das Gefecht. Ein Geschoss durchschlägt die Decke der Schule.
Freyburg. Karl Reinhold organisiert aus Freyburg (Karte) Verstärkung. zurück In der Stadt an der Unstrut hörte man längst von den Vorgängen im sechs Kilometer entfernten Naumburg. Auf dem Markt sammeln sich Arbeiter und einige Einwohner aus der Umgebung. Sie bilden eine kleine Rote Armee. Der Handarbeiter stellt sich an ihre Spitze. Die Menge fordert von der Einwohnerwehr die Waffen. Freiwillige requirieren das Lastauto eines Kohlenhändlers. Es bringt die Kampfentschlossenen um die Mittagszeit nach Naumburg. Reinhold folgt ihnen mit dem Fahrrad. Unversehens fällt er der Reichswehr in die Arme. Sie nimmt ihn gefangen. In der Kaserne wird der bolschewistische Hetzer verhört und misshandelt.
Karl Reinhold ist dreißig Jahre alt, verheiratet und Vater eines Kindes. Der aus der Nazizeit unrühmlich bekannte Kriminalsekretär Paul Scholz (Naumburg) weiß noch mehr über ihn, weiß es ganz genau:
"Reinhold war in russischer Gefangenschaft (Ueberläufer) und soll dort der Roten Armee angehört haben." "Mein Vertrauensmann nimmt mit Bestimmtheit an, daß Reinhold russischer Agent ist und Geld von Russland zu bolschewistischen Propagandazwecken erhält." (Reinhold)
Bei seiner Festnahme soll der Mann aus der Neustraße 57 viel Geld mit sich geführt haben. Die Polizei sieht in ihm einen Rädelsführer der aufrührerischen Arbeiterschaft Naumburgs.
Paul Scholz gibt im Mai 1920 weitere Erkenntnisse über den Schachtarbeiter aus der Grube Rossbach preis:
"Reinhold äußerte sich in einem hiesigen Zigarrengeschäft, daß es bald wieder losgehen werde. Diesmal solle Naumburg a. S. in Grund und Boden geschossen werden; sie seien jetzt schlauer geworden und Geld sei auch genug vorhanden.
Der Feldwebel, der ihn [Reinhold] in der Kaserne misshandelt habe, (ein gewisser Karl Höser) solle mit noch zwei Hauptleuten zuerst um die Ecke gebracht werden." (Reinhold)
Das Schwurgericht Naumburg verurteilt am 29. Juli 1920 Karl Reinhold wegen Landfriedensbruch zu fünf Jahren Gefängnis und drei Jahren Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Im September 1920 befreit ihn die Amnestie.
 |
|
Ehemals Ecke Eckhardt-Pforta-Straße. Karte Stand: 1937 |
Naumburg. An der Ecke Eckhardt-Straße - Pforta-Straße kommt es zwischen der Einwohnerwehr und dem Aktionsausschuss zum Schusswechsel. zurück Laut Naumburger Tageblatt (Ausgabe 1935) trug sich folgendes zu:
Eine Radfahrerpatrouille von 27 Mann wird an der Eckardtstraße - Pfortastraße - Seminarstraße von den Roten angegriffen. Willibald Knoll erhielt einen Rückenschuss und verstarb. Walter Thieme beobachtete dies vom Garten aus und wurde ebenfalls von den „Roten“ niedergeschossen. Der Führer des Radtrupps Kamerad Forwerk kam ebenfalls ums Leben. Stundenlang tobte der Kampf auf dem Platz. Schließlich war die „Stellung“ nicht zu halten. Rückzug. Gegen 3 Uhr beauftragte Kamerad Bass, die Kämpfer eine neue Stellung einzunehmen. Von Bad Kösen kommend erhielten sie vom „Regiment 32“ Unterstützung.
|
|
 |
|
Denkmal (1935) |
Aus Anlass des 15. Jahrestages der Wiederkehr des Kapp-Putsches errichtet die Stadtverwaltung im März 1935 am Ende der Eupener Straße (Seminarstraße) zu Ehren von Willibald Knoll und Walter Thieme ein Denkmal.
Die Streikenden waren, was das Naumburger Tageblatt vom 14. März verschweigt, einem Aufruf der Regierung zur Verteidigung der Demokratie gefolgt. Außerdem zählt die Zeitung nur zwei Tote, Thieme und Knoll. In Wirklichkeit kamen viel mehr Bürger ums Leben. Batterie und Radfahrpatrouille beklagen laut Arthur Dietrich (9.4.1920) zwei Tote und vier bis sechs Verletzte.
 |
|
Blick aus Richtung Domplatz zum Oberlandesgericht (2011)
|
Um die Mittagszeit kommt Otto Hug vom Michaelistor herüber zum Domplatz. Unterwegs wechselte er mit den Soldaten der Reichswehr am Oberlandesgericht Schüsse und bezieht dann zusammen mit anderen Kämpfern an der Ecke Neuer Steinweg / Domplatz Stellung. zurück Von hier kann er das Haus 20, Schneidersches Haus auch geannt, auf dem Domplatz einsehen. 1930 birgt hier die Weißenfelser Schutzpolizei große Mengen an Waffen. Wieder ein paar Jahre später richtet Friedrich Muck Lamberty hier seine Werkstatt ein.
Auf der Linie Ecke Neuer Steinweg - Domplatz - Oberlandesgericht fliegen die Kugeln hin und her. Hier bezieht Otto Hug seine Kampfposition. Er wolle den Kapp-Putsch abwehren, verteidigt er sich später vor dem Geschworenengericht in Naumburg.
 Die
Marienkirche verdeckt die Längsseite des Hauses Domplatz 20.
Von der Ecke Neuer Steinweg-Domplatz kann man die Giebelseite einsehen.
Hier, im so genannten Schneiderschen Haus, liegt im zweiten Stockwerk
das Arbeitszimmer des Kunstmalers Fritz Amann (1878-1969). Seine Frau,
die mit ihm hinter dem Fenster steht, ereilt eine tödliche Kugel.
Hug gibt zu, auf das Haus geschossen zu haben, aber nicht auf das Fenster,
hinter dem das Ehepaar Amann stand. Das nicht! Auf keinen Fall! Er würde,
sagt er, nie auf Unbewaffnete schiessen. Aber das hörte man schon
mal anders. Am Tag nach seiner Verhaftung, dem 24. März, soll
er den Schuss in Richtung Fenster zugegeben haben. - Vor der
Tat umringen
ihn mehrere Kämpfer. Als das Unfassbare geschieht, stehen dort angeblich
nur noch zwei. Einer davon ist Hug. Trotzdem bleibt es dabei: Er schiesst
nicht, sagt er vor Gericht, auf unbewaffnete Menschen. Indessen halten
ihn aufgrund der Indizien die Geschworenen des versuchten Mordes in Tateinheit
mit Landfriedensbruch und unerlaubtem Waffenbesitz für schuldig.
Fünf Jahre Zuchthaus und fünf Jahre Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte, lautet das Urteil am 5. August 1920 für den Zwanzigjährigen.
Die
Marienkirche verdeckt die Längsseite des Hauses Domplatz 20.
Von der Ecke Neuer Steinweg-Domplatz kann man die Giebelseite einsehen.
Hier, im so genannten Schneiderschen Haus, liegt im zweiten Stockwerk
das Arbeitszimmer des Kunstmalers Fritz Amann (1878-1969). Seine Frau,
die mit ihm hinter dem Fenster steht, ereilt eine tödliche Kugel.
Hug gibt zu, auf das Haus geschossen zu haben, aber nicht auf das Fenster,
hinter dem das Ehepaar Amann stand. Das nicht! Auf keinen Fall! Er würde,
sagt er, nie auf Unbewaffnete schiessen. Aber das hörte man schon
mal anders. Am Tag nach seiner Verhaftung, dem 24. März, soll
er den Schuss in Richtung Fenster zugegeben haben. - Vor der
Tat umringen
ihn mehrere Kämpfer. Als das Unfassbare geschieht, stehen dort angeblich
nur noch zwei. Einer davon ist Hug. Trotzdem bleibt es dabei: Er schiesst
nicht, sagt er vor Gericht, auf unbewaffnete Menschen. Indessen halten
ihn aufgrund der Indizien die Geschworenen des versuchten Mordes in Tateinheit
mit Landfriedensbruch und unerlaubtem Waffenbesitz für schuldig.
Fünf Jahre Zuchthaus und fünf Jahre Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte, lautet das Urteil am 5. August 1920 für den Zwanzigjährigen.
Kunstmaler Fritz Amann lebte noch bis 1969 in Naumburg.
|
Bad Kösen. "Eine stark bewaffnete Kampfgruppe von Arbeitern, die von Naumburg abgedrängt war und sich in der Nähe der Cucuclauerstrasse [Kukulauer Strasse-] im Walde befand, wurde zur Unterstützung der Bad Kösener Arbeiter von dem Genossen Firchau zu der Versammlung [in der Tanne] hinzugezogen." (Firchau 1918-1945) Bei der abgedrängten Gruppe handelt es sich um Fieker und seine Mannen, die sich morgens in der Lehmgrube am Rande von Naumburg getroffen hatten.
 |
|
Gasthaus zur
Tanne In der Tanne sprach am 25. Januar 1919 ½ 8 Uhr Rechtsanwalt Doktor Otto Hollaender aus Naumburg über die Politik der Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Nach menschlichem Ermessen kann der Vortrag und Auftritt nicht schlecht gewesen sein, wenn seine Partei vier Tage darauf im Kreis Naumburg Stadt und Land (mit Bad Kösen) bei den Wahlen zur Nationalversammlung hinter der SPD und mit einer Differenz von nur 128 Stimmen zur zweitstärksten politischen Gruppierung avancierte. |
"Die reaktionären Kräfte in Bad Kösen, die Telefon und Post beherrschten, hatten nichts Eiligeres zu tun, als 3 Kompanien der sogenannten schwarzen Reichswehr herbeizurufen." zurück Im Kern stimmt dies mit Informationen aus einer anderen Darstellung überein, die feststellt: Einwohner machten die Truppe (Reichswehr) auf die Arbeiterversammlung in der Tanne aufmerksam, worauf nun der gesamte Bereich unter Feuer genommen wurde. (Vgl. Budde) Die da aufmerksam machten, .... bestanden", nach Gottfried Kormann (1954, 55), "vorwiegend aus Grossbauern der umliegenden Gemeinden wie Gernstedt, Hassenhausen, Eckhartsberga und anderer Ortschaften in Richtung Weimar. Nicht alle Grossbauern dieser Gegend waren entwaffnet."
Einige Kämpfer der Arbeiterwehr besetzen die Brücke über die Saale, beziehen am Gradierwerk und Bahnhof Stellung.
Gegen 2 Uhr nachmittags trifft die Reichswehr mit schätzungsweise 300 Mann aus Weimar über die Eckartsbergaer Strasse im Stadtgebiet von Bad Kösen ein.
Ein Vorkommando von Offizieren fährt im Kraftfahrzeug den Berg herab. Als die Reichswehr von Weimar schon im Anzug war, wurde ein Kraftwagen mit Offizieren, der von Schulpforta kommend den Truppen entgegenfuhr, an der Kösener Brücke beschossen. zurück Einem Zweiten soll es nicht anders ergangen sein.
 |
 |
|
Brücke
der Einheit über die Saale in Bad Kösen (2013)
|
|
Diesen Augenblick hält Franz Possögel 1962 so fest: "Mein Genosse Reinhardt wurde, als er sich mit fünf anderen Naumburger Arbeitern auf der Brücke in Bad Kösen befand, von den Noske-Truppen erschlagen, obwohl keiner von ihnen Waffen trug."
 |
|
Hermann
Reinhardt
(1894-1920) |
Glaubte das Fünf-Mann-Kommando auf der Brücke wirklich, die Reichswehr [nach Gottfried Kormann drei Kompanien Schwarze Reichswehr?] aus Weimar aufhalten zu können? Wie sah der militärische Plan aus? Gab es ihn überhaupt? - Fieker erzählt dem Staatsanwalt Hardt in Naumburg später, er sei wegen Streikgelder nach Bad Kösen gegangen. 30 bis 40 Männer holen oder bringen, wie auch immer, am 19. März Streikgelder?
Von der Brücke, vom Gradierwerk und von der Tanne her trafen die Reichswehr Schüsse. Deshalb zog die Reichswehr aus Weimar "unter Sicherung mit einer Vorhut in Kösen ein und schickten eine Patrouille über den Jochenberg vor nach dem Gasthaus zu Tanne". "Die erbitterten Soldaten gingen nun unerbittlich vor." (Naumburger Tageblatt, 20. März 1920)
Die Landjäger ziehen mit Maschinengewehren zum Kohlenplatz am Bahnhof, Gradierwerk und an der Tanne. Minenwerfer kommen zum Einsatz. Schlachtgetöse legt sich über die Stadt.
 |
|
Handskizze zur militärischen Lageentwicklung in Bad Kösen am 19. März 1920 - Vollbild |
Unweit von Pforta, auf dem Galgenberg liegen bewaffnete Unabhängige auf der Lauer. Ein Fakt, der nun wieder darauf schließen lässt, dass die Arbeiterwehr doch einen militärischen Plan hatte. Vielleicht wollte sie die Höhen entlang der Saale zwischen Bad Kösen und Naumburg besetzen, um den Marsch der Reichswehr aufzuhalten und die Kameraden in Naumburg zu entlasten? Dagegen spricht wieder, dass sich die Gruppe Fieker in die Tanne begibt, die im Stadtgebiet von Bad Kösen unterhalb der Einfallstrasse aus Richtung Weimar liegt. Und dies war taktisch ein äusserst ungünstiger Ort sowohl für einen Angriff wie für die Verteidigung.
Aber wahrscheinlich ahnte die Gruppe Fieker von dem bevorstehenden Eintreffen der Reichswehr aus Weimar in Bad Kösen nichts. Sie hatte möglicherweise nur die Konfrontation der Arbeiter mit der Kösener Einwohnerwehr im Auge ....
Es muss nach 2 Uhr nachmittags gewesen sein, als das Gefecht (in Bad Kösen) um die Tanne begann. zurück
"10 Minuten vor dem Überfall", rekonstruiert Hermann Firchau viele Jahre später die Lage, "bekamen wir die Meldung von einem Telegraphenarbeiter, das 3 Kompanien schwer bewaffnet sich in Anmarsch nach Bad Kösen befanden." Er erhält den Auftrag festzustellen, welche Maßnahmen die 3 Kompanien planen, gerät aber am Kurgarten als erster in Gefangenschaft. In dem Wirrwarr gelingt ihm aber die Flucht.
 |
|
Blick
in Richtung zur Tanne (2007). Das Gebäude wurde
bereits abgerissen.
|
Vom Bahnhof schiesst die Reichswehr auf die Tanne. Sie soll dabei ihre eigenen Gruppen als Arbeiterwehr verkannt haben. Es "....krachten Minen, Handgranaten und knatterten Maschinengewehre. Das war der Beginn des Überfalls. Der Überfall kam so überraschend, dass die Naumburger Kampfgruppe nicht mehr in der Lage war, die Gewehre, die in der Kolonnade vor dem Saal abgestellt waren, zu erreichen, dadurch waren die Arbeiter wehrlos den Angreifern ausgesetzt.
Der Genosse Paul Morchner von Freiroda hatte als Einzelner vorn am Stadteingang die Aufgabe die Gewehre zu sichern. Verteidigte sich mutig bis zur letzten Patrone und wurde nachdem von rasenden Angreifern mit dem Gewehrkolben erschlagen." (Firchau 1919-1945; Kormann 1954)
 |
 |
 |
||
 |
 |
 |
||
|
Das
Grab von Paul Morchner am 24. Oktober 2011
|
||||
Einen Tag nach dem Gefecht schildert Walter Fieker die Konfrontation mit der Reichswehr gegenüber Staatsanwalt Hardt (20.3.) so: "Als wir in der Tanne sassen, eröffneten die Landesjäger einen plötzlichen Angriff. Die meisten Arbeiter stürmten mit Waffen heraus. Es entwickelte sich ein Kampf. Ich liess den Revolver auf dem Tisch liegen, legte mich in Deckung hinter den Bahndamm und habe dann das Feuer durch ein weißes Tuch zum Schweigen gebracht." "Waffen habe ich bei meiner Festnahme nicht gehabt. Wer Waffen hatte, wurde sofort erschossen", gibt er weiter zu Protokoll. Am 23. März wird gegen ihn wegen Paragraf 125 (Landfriedensbruch) ein Haftbefehl erlassen.
 |
|
Blick
in Richtung zur Tanne (2007) mit Gedenktafel
|
 |
|
Gedenktafel
(2007)
|
|
Die Paul Morchner Felix Hertel Hermann Reinhardt Franz Neubert Paul Heese Franz Jahr Otto Hering Karl Albrecht Adolf Jahr Karl Schmidt August Mieske Eduard Kryge Walter Klahr
|
"… ein 16-jähriger Junge aus Bad Kösen [wahrscheinlich Paul Felix Hertel], der nichts mit den Kämpfe[n] zu tun hatte, wurde von einem Feldwebel mit der Pistole erschossen. "Dieser Feldwebel", behauptet Eugen Wallbaum um 1950, "soll nach Angaben des Genossen Burkhardt und Ronneburg der Kohlehändler Eickmann sein."
Für Herrn Schütze (Naumburg), der beim Gefecht um die Tanne dabei war, ist 1960 noch immer präsent: Die "Noskiten" drangen in das Lokal ein. "Es ist nicht zu schildern, wie sie hier hausten. Obwohl sich die Arbeiter nicht im Besitz der Gewehre befanden, diese hatten sie in der Kolonnade abgestellt, schoss, hieb und stach die einheimische Soldateska auf die Wehrlosen ein, dass sie bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt wurden. Dreizehn Tote blieben am Tatort." (Wsf 33)
"Die zum Teil betrunkenen Noskiten stürzten sich auf uns", bewahrte Hugo Wolf im Gedächtnis. Wer bei diesem Massaker nicht sofort getötet wurde, wurde geschlagen und nach Waffen durchsucht. Neben mir stand ein junger Arbeiter. Man fand bei ihm Patronen. In der Jackentasche. Sofort wurde er an die Wand gestellt und mit der Pistole erschossen." (Wsf 34)
"Eines wundert mich," rätselt am 7. April 1920 das SPD-Mitglied August Huth (Bad Kösen, Saalberg 7), "dass nach Bad Kösen noch niemand gekommen ist, um das erbärmliche Morden der Reichswehr zu untersuchen. Ich habe als alter Landwehrmann auf drei Kriegsschauplätzen gekämpft. Aber so ein gemeines, viehisches Gesindel habe ich nicht gesehen."
Am 21. Juli 1920 8 Uhr abends lädt das Gewerkschaftskartell zur Großen Protestversammlung gegen das Naumburger Schandurteil über die Märzopfer ein. Bei der Gelegenheit erzählt Walter Fieker eine ganze andere Geschichte über das Gefecht an der Tanne. Im Ort ging das Gerücht um, dass 4 000 Spartakisten auf dem Weg nach Hassenhausen [Karte] zu den dort liegenden Reichswehrtruppen sind. So stand es auf einem Telegramm, das damals allgemein bekannt wurde. Die Nachricht erwies sich als falsch und hatte verheerende Folgen. Denn die Reichswehr versetzte die Arbeiter in höchste Anspannung und mobilisierte ihrerseits entsprechende Kräfte. Folglich ist "der Urheber" des Telegramms "als der Schuldige an den gesamten blutigen Vorgängen in Naumburg und Bad Kösen anzusehen". "Es wäre stark zu vermuten, dass er aus dem Rathause oder vielleicht auch in der Kaserne zu suchen sei", beendet Walter Fieker seine Ausführungen.
Rückkehr der Reichswehrtruppen nach Naumburg zurück
Um 5 1/2 Uhr nachmittags marschiert laut dem Führer der Bürgerwehrabteilung I T die (Schwarze?) Reichswehr in die Stadt ein. Durch den Einsatz von Artillerie und schweren Waffen weist sie in den Kampfgebieten Zerstörungen auf. Umgehend stürmt die Reichswehr den Goldenen Hahn, wo die Streikleitung oft tagte und sich die Arbeiter beim Bier trafen. Wahrscheinlich warteten die Kapp-Gegner hier nicht auf ihre Verhaftung. Bevor die Reichswehr eintraf, transportierten sie die noch vorhandenen Waffen ab und versteckten sie anderen Ortes.
"Infolge des Eingreifens des inzwischen von Weimar zur Hilfe heranmarschierenden Bataillons ziehen sich die Arbeiter zurück, verstecken in Gärten, Lauben und sonstigen Orten ihre Gewehre und erscheinen nach dem Einzug des Bataillons als harmlose Bürger in der Stadt", berichtet Bürgermeister Dietrich am 9. April 1920 an Richard Krüger, Zivilkommissar für den Regierungsbezirk Merseburg. "Die zahlreichen fremden Arbeiter finden bei den hiesigen Arbeitern Unterkunft. .... Ein Reichswehrsoldat ist von einem Zigeuner, der sich den Aufrührern angeschlossen hatte, meuchlings niedergeschossen worden."
Durch den Einmarsch der Reichswehr "entfiel", stellt erleichtert Johannes Kegel fest, "die überaus drohende Gefahr eines Angriffes auf Schwurgericht und Gefängnis sowie der Plünderung der Stadt [, die] für die Nacht zum Sonnabend wohl mit Sicherheit zu erwarten gewesen wäre." - Die Gefahr der Plünderung kann an Hand vorliegender Dokumente nicht verifiziert werden. Hingegen war aber eine Befreiung der politischen Häftlinge aus dem Gefängnis schon angedacht und immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Gegen 11 Uhr vormittags erschienen beim Ersten Staatsanwalt von Naumburg eine Zeitzer Arbeiterdelegation und forderte die Freilassung der Gefangenen, die seit März 1919 wegen der Unruhen in Zeitz in Untersuchungshaft einsassen. Der Erste Staatsanwalt lehnt das kompromisslos ab.
Wohl deshalb, also in Ansehung der Gesamtlage, befürchteten die Abteilungsführer der Einwohnerwehren, "dass sie ohne Sukkurs [Hilfe, Beistand] ihre Posten gegen einen Angriff nur bis Morgen 20. März 1920 halten könnten."
Der Kampf in Naumburg ist beendet.
"Die Batterie und die Radfahrerpatrouille haben zwei Tote und wohl 4-6 Verwundete, die Einwohnerwehr hat zwei Tote und sechs Verwundete." (Dietrich 9.4.1920)
"Am 19. März sind Teile der Brigade in Naumburg eingerückt", meldet das Nachrichten-Blatt der Reichswehrbrigade XVI am 22. März, "um die in den Vortagen gestörte Ordnung und Sicherheit wieder herzustellen. Die Truppen halten treu zur Regierung Ebert-Bauer. Es besteht gute Aussicht für Wiederaufnahme der Arbeit. Die Sperrzeit ist von 9 Uhr abends bis 5 Uhr festgesetzt. Zahlreiche Zweitfreiwillige strömen der Reichswehrbrigade XVI zu."
|
Im Widerstand gegen den Kapp-Putsch verloren ihr Leben zurück
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
10.2.1894-
19.3.1920 |
|
|
|
|||
|
22.7.1900-
19.3.1920 |
|
|
|
|||
|
13.3.1881-
19.3.1920 |
|
|
|
|||
|
28.8.1901-
19.3.1920 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
11.1.1900-
19.3.1920 |
|
|
|
|||
|
|
||
|
20.11.1903-
19.3.1920
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|||
Gefangennahme und Abtransport zurück
 |
|
Alte
Mühle am Wehr in Bad Kösen (2002); zerstört beim
Großbrand am 14. September 2007. Fotograf: Christian Bier,
2002.
|
 |
|
Bad Kösen, Saalewehr und Alte Mühle. Fotograf: Norbert Kaiser, 2009. Bildlizenzen erlauben hier eine Veröffentlichung. |
Das Militär nimmt Walter Fieker, einige Mitglieder seiner Gruppe und weitere Kämpfer aus Bad Kösen, insgesamt 26 Personen, gefangen. Sie kommen zunächst in die Alte Mühle an der Saale und dann nach Schulpforta, wo sie über Nacht in den Kohlenkeller eingesperrt werden. Mit Hände hoch, von den Soldaten gezwungen "Deutschland, Deutschland über alles" zu singen, ging es dann am nächsten Tag nach Naumburg. "Auf diesem Marsch," so Hugo Wolf, "wurden wir weiter misshandelt und geschlagen und mussten die Arme hochhalten. So wurden wir in das Gefängnis eingeliefert." (Wsf 34)
.... anders verdienen sie es nicht zurück
"Das tollste aber ist das Benehmen des Staatsanwaltschaftsrates Hardt [geboren 1874] in Naumburg", legt Bernhard Düwell in seiner Rede vor der Nationalversammlung am 29. Juli 1920 dar. Er verhörte einen in Untersuchungshaft genommenen Arbeiter, der in Bad Kösen einen Soldatentrupp geführt hatte. Dabei war ein Feldwebel anwesend, den er fragte, "weshalb die sieben Arbeiter in Kösen erschossen worden sind", worauf der antwortet, ".... dass die allgemeine Parole gewesen sei, jeden Arbeiter der im Waffenbesitz gefunden würde,
über den Haufen zu schiessen,
und das könne geschehen, ohne dass man vorher die Offiziere frage. (....) Darauf erwiderte angeblich der Staatsanwaltschaftsrat Hardt, dieses Musterbeispiel eines objektiven Juristen:
das haben sie richtig gemacht,
anders verdienen sie es nicht."
Am 18. August 1920 gibt Staatsanwalt Hardt folgende amtliche Gegendarstellung:
"Ich habe mich bei den Vernehmungen auf den Standpunkt gestellt, dass die mit der Waffe in der Hand im Kampf gefangenen Beschuldigten Aufrührer waren. Denselben Standpunkt vertrete ich auch jetzt noch. Ich habe absichtlich keinem der vernommenen Landesjäger einen Vorwurf daraus gemacht, dass er einen bewaffneten Aufrührer im Kampf erschossen hat."
Staatsanwalt Hardt sympathisierte mit den Putschisten. Dazu legt der Abgeordnete des Reichstages Bernhard Düwell am 29. Juli 1920 seine Schlussfolgerung vor dem Hohen Haus dar:
"Mit solchem Recht sind wir verpflichtet, zu sagen, dass speziell die Handlungsweise des Naumburger Schwurgerichts, der Naumburger Strafkammer nicht nur ein Rechtsverbrechen ist, sondern eine bewusste Vorschubleistung für das Unternehmen der Kapp-Lüttwitz-Verbrecher, Menschen, wie dieser Staatsanwaltschaftsrat Hardt, der sich mit dem Kapp-Lüttwitz durchaus solidarisch fühlte, wagen es dann noch, Leute anzuklagen und über Leute zu Gericht zu sitzen, die gegen die Kapp-Lüttwitz die Waffe erhoben hatten."
Verhaftungs- und Säuberungswelle zurück
Noch am Abend des 19. März erfolgt die Festnahme des 22jährigen Obster Otto Winkler aus der Schulstraße 27. Er soll von der Dompredigergasse entlang der Georgenmauer in Richtung Westen auf das Militär geschossen haben. In der Wohnung des Handarbeiters findet die Polizei eine Pistole.
Durch das Naumburger Land schwappt eine Verhaftungs- und Säuberungswelle.
"Von böswilliger Seite wir ausgestreut, dass in Naumburg zahlreiche Verhaftungen vorgenommen seien", lautet am 25. März die offizielle Gegendarstellung der Stadtzeitung unter dem Titel Haltloses Gerücht. "Das trifft nach Mitteilungen der Reichswehrbrigade 16 nicht zu. Nur Auswärtige, die auf frischer Tat ertappt wurden, sind verhaftet. Bei anderen sind nur die Namen festgestellt worden."
War
der militärische Kampf
in Naumburg notwendig? zurück
Am 19. März kämpften die Kapp-Gegner im Gebiet Moritzwiesen-Oberlandesgericht-Dom und in anderen Arealen des Stadtgebietes gegen die Reichs- und Einwohnerwehr.
Besonderes Interesse zieht die Frage auf sich, wie und warum der Übergang vom gewaltfreien Generalstreik zum militärischen Kampf erfolgte. Dies erhellt der gemässigte Sozialdemokrat und Stadtverordnete August Winkler (Naumburg) am 3. August 1920 vor dem Naumburger Schwurgericht mit der Aussage:
"Als der Kapp-Putsch bekannt geworden war, hatte sofort die organisierte Arbeiterschaft dazu Stellung genommen. In der betreffenden Sitzung der Gewerkschaften war gesagt: Es ist jetzt nicht die Zeit, politische Ziele zu verfolgen, es gilt jetzt zusammenzustehen und deshalb muss der Generalstreik verkündet werden. Die Erregung hat sich gesteigert als aus Weimar die Nachricht kam, daß von der Reichswehr die Regierung aufgelöst worden und der mehrheitssozialistische Ministerpräsident Baudert gefangen genommen worden sei.
Das Naumburger Jägerbataillon [= Reichswehrbrigade 16] war in Weimar und stand nach Ansicht der Arbeiter auf Seite Kapp-Lüttwitz."
Bernhard Düwell erhärtet dies am 29. Juli 1920 in seiner Rede vor dem Reichstag, die oben bereits im Zusammenhang mit den Ereignissen am 13. März wiedergegeben wurde.
Eine weitere interessante Frage lautet: Obwohl hoffnungslos unterlegen, begannen die Akteure des Aktionsausschusses am 19. den Kampf. Warum taten sie das, zumal aus Weimar jederzeit weitere Naumburger Truppenteile in die Stadt zurückkehren konnten?
[A] Der blutige Dienstag (16. März) löste bei nicht wenigen Bürgern und Kapp-Gegnern Wut und Empörung aus, erhärtete ihr Misstrauen zur Reichswehr und zerstörte ihr Vertrauen zum Oberbürgermeister Arthur Dietrich. Im Vorgehen der Reichswehr und Sipo (Sicherheitspolizei) erkannten viele ein typisches Muster, dass sich anderen Ortes wiederholte (zum Beispiel Leipzig 14.3., Weimar 15.3. oder Weißenfels 16.3.). Vor einem Jahr, beim Einsatz der Truppen in Zeitz und Halle, war es ähnlich, was ihnen noch gut in Erinnerung ist. Ihr Dienst am Vaterland im letzten Krieg war vergessen.
[B] Warum aber zogen sie jetzt in den Kampf, obwohl er aufgrund des Kräftekonstellation militärisch gesehen aussichtslos war? Eine mögliche Antwort lautet: Sie wollten die Rolle rückwärts der Reichswehr nicht mitmachen. - Vielleicht drängten auch Momente in das Geschehen, die uns heute gänzlich unbekannt sind. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Bezirksleitung den Befehl zum Aufmarsch gab, um die Kämpfer in Halle zu entlasten und die Reichswehr in Naumburg zu binden.
[C] Zu den Kämpfen wäre es wahrscheinlich nicht gekommen, wenn, was nicht der Fall war und bereits erörtert wurde, die Naumburger Einwohnerwehr den Putsch entgegengetreten wäre. Aber deren Sache als republikanische Organisation gedacht, die lediglich der Ordnung und Sicherheit dienen sollte, war in den Händen von Kreisrat Max Jüttner bereits verloren, bevor sie überhaupt die richtige Richtung einschlagen konnte.
Nicht von ungefähr rühmt am 28. April 1935 der Senatspräsident Doktor Müller vom Oberlandesgericht in seiner Rede in Naumburg vor dem
Denkmal für die Gefallenen
der ehemaligen Einwohnerwehr und des Landesjägerkorps
diese zivilen Kampfverbände:
"Alte Freikorpskämpfer und Einwohnerwehrleute sind sicherlich, nicht die schlechtesten unter den Kämpfern in den Reihen der SA, der SS und der Bewegung …."
Es blieb nur, wie es die Vereinbarung von Halle vom 26. März (1920) für den Regierungsbezirk Merseburg (mit Naumburg) vorsieht, die Auflösung der Einwohnerwehren und Zeitfreiwilligenverbände.
|
Im
Widerstand gegen den Kapp-Putsch
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Zur
Sicherheitslage zurück
Die Einhaltung der Gesetze zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung bereitet den Naumburger "Stadtvätern" schon seit der Kriegszeit Sorgen.
Jetzt - im März / April 1920 - bewacht die Einwohnerwehr das Gefängnis, das Schwurgericht, das Artilleriedepot und den Bahnhof. Diese Objekte sind gefährdet, fürchtet Oberbürgermeister Arthur Dietrich, sollte sie sich aus diesen Aufgaben zurückziehen.
"Am 6. Mai 1920 beginnen hier die Schwurgerichtsverhandlungen wegen der gelegentlich des Generalstreiks 1919 in Zeitz usw. begangenen Aufruhr- und Landesfriedenbruchs-Verbrechen, wozu etwa 200 Zeugen geladen sind", notiert Bürgermeister Karl Roloff im April 1920 und fährt fort: "Diese Verhandlungen werden mehrere Wochen dauern. Im hiesigen Gerichtsgefängnis befinden sich gegenwärtig annähernd 400 Gefangene, darunter viele politische, deren sofortige Befreiung von den Radikalen fortgesetzt gefordert wird."
Der Zeitzer Landesfriedensbruchprozess gegen 45 Angeklagte beginnt schliesslich am 31. Mai 1920 in Naumburg unter Vorsitz von Landgerichtsdirektor Hagen.
Bernhard Düwell, Albert Bergholz und Adolf Leopoldt betrachten das Naumburger Gefängnis als ein Hort der Klassenjustiz (1, 2, 3, 4). Es ist drastisch überfüllt. Aus Empörung über die lange Untersuchungshaft, drohen die Arbeiter öfter die Befreiung der Politischen an. "Hinzu kommt noch," stellt Arthur Dietrich (Oberbürgermeister) fest, "dass die Reichstagswahlkämpfe sich hier voraussichtlich sehr heftig gestalten werden.
Diese Verhältnisse lassen u. E. vorbeugende Maßnahmen unbedingt notwendig erscheinen und zwar nicht nur für den 1. Mai … [handschriftliche Einfügung], sondern bis auf weiteres.
Deswegen bitten wir
das Garnisonkommando ergebenst und dringend, dahin wirken zu wollen, daß
die Stadt nicht wieder, wie Mitte März, von Truppen fast völlig
entblößt wird." (Die Polizeiverwaltung 22. April
1920)
"Neben dem Gefängnis sind nach dem Abzuge der Reichswehr in der Stadt Naumburg aber auch noch mehr als 50 Militärgebäude, die zum Teil einen sehr wertvollen Inhalt bergen, zu schützen. …. Hierzu, und um noch einen notdürftigen Schutz der Stadt im Allgemeinen zu gewährleisten, sind aber mindestens 2 Hundertschaften erforderlich." (Vgl. OB 14.4.1920, Roloff 22.4.1920, Roloff 21.3.1921)
Entwaffnung zurück
Die Entwaffnung der Bürger bereitet erhebliche Schwierigkeiten. Am 19. März 1920 befiehlt der Militärkommandant von Naumburg:
"Sämtliche Waffen sind unverzüglich spätestens am 20. März [1920] 9 Uhr vormittags abzuliefern. Die Ablieferung für die Einwohner der Stadt Naumburg hat in der Jägerkaserne zu erfolgen, für die Einwohner der anderen Ortschaften an den von den drei Polizeibehörden zu bestimmenden Stellen."
|
Zum 26. März 1920, 6 Uhr nachmittags, ordnet Oberst von Feldmann für Naumburg (Saale) und Umgebung erneut die Abgabe aller Waffen an, was auch diesmal, kein durchschlagender Erfolg wird.
"Die Arbeiterschaft hält die Waffen," meldet Oberbürgermeister Arthur Dietrich dem Zivilkommissar für den Regierungsbezirk Merseburg (Weißenfels, Zeitz, Naumburg), "darunter zahlreiche Maschinengewehre nach wie vor versteckt, Karabiner und Gewehre sind wahrscheinlich zum Teil vergraben." Wie einem Schreiben vom 9. April 1920 unschwer zu entnehmen ist, bereitet ihm das grosse Sorgen. Er fürchtet, "wenn nicht die Waffenabgabe in durchgreifender Weise organisiert und durchgeführt wird, besteht unzweifelhaft die Gefahr, dass die radikale Arbeiterschaft demnächst von neuen die Waffen ergreift. Die Zahl der versteckten Waffen ist gar nicht abzuschätzen."
Die Abgabe der Schiessinstrumente verläuft schleppend.
Am 7. August 1920 beschliesst der Reichstag das Gesetz über die Entwaffnung der Bevölkerung. Hernach geht die Ablieferung der Militärwaffen etwas zügiger vonstatten. Bei Abgabe der Waffe muss der Besitzer nicht seinen Namen angeben und erhält sofort eine Prämie. Zusätzlich führt die Sipo Entwaffnungsaktionen durch.
In Kreipitzsch findet man bei Oberst a. D. Schönberg im Felsenkeller 381 Gewehre, 18 Maschinengewehre, Scheinwerfer und 3000 Schuss Munition. (Weber 38 f.)
|
20. März, Sonnabend zurück
Die Vertreterkonferenz der am Generalstreik beteiligten Gewerkschaften geben um 7.05 Uhr morgens in Berlin bekannt, dass die erzielten Vereinbarungen mit den Fraktionen der Regierungsparteien sie nicht restlos zufrieden stellt, ihnen aber gleichwohl zustimmen und "hiermit den Generalstreik mit dem heutigen Tage als beendet" erklären. (Vgl. Verhandlungen)
Naumburg. Vor dem Gefängnis auf dem Roonplatz herrscht weiter Unruhe.
Weißenfels. zurück Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, Polizeiinspektor und Stadtverordnetenvorsteher von Weißenfels unternahm Albert Bergholz (USPD, Zeitz) den Versuch, durch Verhandlung die Sipo zur Abgabe der Waffen und zum Abzug nach Naumburg zu bewegen. Das scheitert. Eine persönliche Rücksprache mit dem Regierungskommissar Richard Krüger (1880-1965) in Merseburg, später Polizeipräsident von Weißenfels, bleibt ohne Ergebnis.
 |
|
Blick
vom Schloss Weißenfels
auf die Stadt (2012) |
 |
|
Blick
zum Schloss
Weißenfels (2012) |
Das Nachrichtenblatt der Reichswehrbrigade XVI meldet am 22. März, dass die Sicherheitspolizei (250 Mann) sich gestern [am 21. März] unter schweren Kämpfen von Weißenfels nach Naumburg durchgeschlagen hat. "Trotz getroffenen Abkommens, die Polizei in Ruhe abmarschieren zu lassen, musste sich diese den Auszug [vom Schloss Neu-Augustusburg] mit Artilleriefeuer öffnen und wurde auf dem Marsche von kämpfenden roten Banden begleitet."
Im Einzelnen könnte sich der Kampf um das Schloss in Weißenfels in der Nacht vom 20. zum 21. März etwa so zugetragen haben: Aus Hohenmölsen, Teuchern, Zeitz und anderen Orten eilen zur Verstärkung "eine große Anzahl von Arbeiter" (Leopoldt) herbei. "Landfremdes Gesindel", nennt sie später die NSDAP. Gas, Wasser und Elektrizität für die Sipo sind bereits abgesperrt. Auf den anliegenden Häuserdächern zum Schloss lauern die Schützen der Arbeiterwehr. Ab und an fegt von der Höhe des Schlosses die Sipo mit dem Maschinengewehr über die Dächer hinweg. Recht bald zerschiessen die Arbeiter die Scheinwerfer.
Eine Sipo-Abteilung versucht gegen 5 Uhr früh einen Ausbruch.
"In den frühen Morgenstunden machte die Sipo einen Ausbruchversuch, um sich nach Naumburg durchzuschlagen." Zuvor setzte sie vom Turm des Schlosses eine Mine mitten auf den Marktplatz, um den Überraschungseffekt auszunutzen. "Infolge eines Fehlers der Leitung der Arbeiterwehren bei der Verteilung der Kräfte, hatte sich eine Lücke im Belagerungsring ergeben. Der Polizei gelang es, den rechten Flügel der Arbeiterwehren zurückzudrücken und freies Gelände zu erzwingen. Sie nutzen gefangene Arbeiter als Rückendeckung auf ihrer panischen Flucht nach Naumburg und zwangen dadurch die Arbeiterwehren, ihr Feuer einzustellen." (Zeitzer 1959/60, 216)
In Vorahnung am Interesse der Arbeiterwehr für ihre Waffen, füllte die Sipo vor dem Ausbruch vom Schloss Neu-Augustusburg den Brunnen mit 749 Gewehren und Karabinern, 28 leichten und 11 schweren Maschinengewehre, 2 500 Granaten und 762 000 Patronen. (Vgl. Wsf 72). Gewiss kämen die Waffen vom Wiedebacher Hohlweg eh zu spät, denn in Halle beginnen bereits die Ausgleichsverhandlungen zwischen Garnisonskommando und bewaffneten Arbeitern.
Auf der Strasse angelangt, gerät die mit Gewehren, Handgranaten, Minenwerfern, Maschinengewehren und Geschützen ausgerüstete Sipo sofort in das Sperrfeuer der Arbeiter, die das Feuer erwiedert. Wo sich nur die Gardine bewegt, schiesst sie ins Fenster hinein. Ihr Marsch führt nach Naumburg, um dort das Gefängnis zu sichern und, womit Reichswehr und Bürgermeister rechnen, eine Umzingelung der Stadt durch die Kapp-Gegner zu verhindern.
Etwa 4 Kilometer südlich von Weißenfels greift die zahlenmässig überlegene Arbeiterwehr die Sipo an, als diese im langgestreckten Hohlweg zwischen Kösslitz-Wiedebach und Unternessa zum Stehen kommt. Ehe sie es sich versehen, sind sie von bewaffneten Arbeiter umschlossen. Ein Sipo-Stosstrupp unternimmt einen Entlastungsangriff. (Dabei der 21jährige Wachtmeister Friedrich Hildebrandt, nach 1933 Reichsstatthalter in Mecklenburg und Lübeck, ab November 1942 Reichsverteidigungskommissar für Mecklenburg.) Sie bugsieren ein Geschütz auf die Anhöhe. Ihr Artilleriefeuer soll eine Bresche in die Umzinglung schlagen. Kaum oben angekommen, geben Material und Sipo eine sichere Zielscheibe ab. Einige von ihnen werden gefangengenommen. "Das gesamte Pferdematerial lag erschossen mit dem Fuhrpark weit verstreut auf den Feldwegen in der Richtung nach Naumburg." (Bergmann) Arbeiter erobern die zwei Geschütze und schaffen sie nach Halle.
In einer Art Tagebuch der Sipo steht geschrieben: "Der Marsch von Weißenfels nach Naumburg gelang nicht ohne Kampf mit den Aufrührern und kostetet der Sicherheitspolizei eine Reihe von Toten und Verwundeten. Ein Teil des Gros und die Nachhut, in Stärke von 2 Offizieren (Oberleutnant Brell und Leutnant Teichmann) und 32 Beamte wurden abgeschnitten und mußten sich nach hartem Kampf, nach Verschuss der Munition und starken Verlusten der Übermacht - nach Angaben der Führer der Aufrührer 5000 Mann - ergeben. Die Freigabe der gefangenen Offiziere und Beamten, welche nach der Kaserne in Merseburg gebracht waren, und der Transport nach Naumburg erfolgten am 24. März 1920.“
Unter erheblichen Verlusten gewinnt der Sipo-Stosstrupp Raum und setzt den Marsch nach Naumburg fort. Die Arbeiter verfolgen sie bis etwa 9 Kilometer östlich von Naumburg nach Plotha.
Ein Major der Sicherheitspolizei macht später als Zeuge vor Gericht die Aussage, dass sie 20 Tote und 40 Verwundete an Verlusten erlitten. "Die Arbeiter hatten hier acht Tote und mehrere Verletzte."
In Naumburg vereinigt sie sich mit der Reichswehrbrigade XVI, die versprach bis 27. März keine Unternehmungen gegen Weißenfels zu beginnen. Joachim Schunke (1956, 73) erkennt darin den Versuch, die Arbeiter von Zeitz und Weißenfels von Angriffen auf Naumburg abzuhalten.
Die Leipziger Volkszeitung meldete am 22. März 1920 auf Seite 2, dass die Truppen in Weissenfels zum Abzug nach Naumburg gezwungen wurden. "In Naumburg sind bayerische Truppen zur Verstärkung eingerückt." (Um den 10. April 1920 traf die im mitteldeutschen Revier in und um Naumburg eingesetzte bayerische Reichswehr zu etwa 2/3 wieder in ihren heimischen Standorten ein.)
Nach dem Abzug der Sipo besetzt die Arbeiterwehr Schloss Neu-Augustusburg und inhaftiert hier 33 Sipo-Leute. Helmut Böttcher behauptet in Die Wahrheit über die Ereignisse in Halle (Saale) und Mitteldeutschland (1920, 87): "Die gefangenen Reichswehrsoldaten wurden in bestialischer Weise hingemordet und vollständig ausgeplündert, einem wurde sogar das Gold aus den Zähnen gebrochen." Über die Behandlung der Gefangenen durch die Arbeiterwehr auf Schloss Neu-Augustusburg führen die bisher ausgewerteten Dokumente keine Klage.
21. März, Sonntag zurück
Kämpfe in Halle, Eisfeld, Merseburg und Sangerhausen.
Weißenfels. Im Rathaus verhandeln die Vertreter der städtischen Körperschaften des Regierungsbezirks Merseburg, darunter Bürgermeister Roloff aus Naumburg, zusammen mit dem Bürgertum und der Weißenfelser Arbeiterwehr. Ihnen liegt ein Entwurf für ein Abkommen zwischen Arbeiterwehr und Reichswehrbrigade (Naumburg) vor. Nach einer Aussprache im Sitzungssaal des Magistrats vereinbaren sie durch Unterschrift: Einhaltung von strikter Ruhe und Ordnung. Dafür verspricht die Reichswehr gegen die Kämpfer bis 27. März, wenn alle Waffen abgegeben werden, nichts zu unternehmen. Ausserdem setzt sie die Wiederaufnahme der Arbeit voraus. Schweren Herzens stimmt die Arbeiterwehr dem Waffenstillstand zu. Alle übrigen Punkte will sie vor Ort in Berlin prüfen lassen. (Vgl. Wsf 40-42)
 |
|
Joachim
Schunke: Die Schlacht um Halle. Gewehre in Arbeiterhand. Die Abwehr
des Kapp-Putsches in Halle und Umgebung. Verlag des Ministeriums
für Nationale Verteidigung, Berlin 1956
|
Halle. Heftige Kämpfe erschüttern die Stadt. Im Goldenen Adler von Ammendorf richtete der Aktionsausschuss am 19. März sein grosses Hauptquartier ein. Am Morgen des 21. März beziehen in Trotha liegende Arbeiter ihre Stellung. Das Zentrum der Front liegt im Norden der Stadt, am Galgenberg (134,2 Meter über Normalhöhennull). Um 5.50 Uhr beginnt das Gefecht. Bewaffnete Arbeiter liefern sich mit der durch Zeitfreiwilligenverbände verstärkten Reichswehr regelrechte Schlachten.
Zu früher Morgenstunde begibt sich Walther Schreiber zu den revolutionären Kampftruppen am Hettstedter Bahnhof und teilt ihnen mit, dass im Auftrag der obersten Provinzialbehörde zwischen dem Garnisonskommando und ihnen Ausgleichsverhandlungen beginnen sollen. Arbeiter übergeben ihm die Forderungen für das Garnisonskommando, unter denen sie bereit wären die Kämpfe abzubrechen: Sofortige Entwaffnung der Zeitfreiwilligen, Rückzug der Reichswehr in die Kasernen, Sicherung der Stadt durch die organisierte Arbeiterschaft, Einfluss auf die Kommandobesetzung der Einwohnerwehr und ihre Entwaffnung. Um 4 Uhr nachmittags beginnen die Verhandlungen im Garnisonskommando. Gleichzeitig unternimmt die Reichswehr einen heftigen, und, wie sich herausstellen sollte, erfolgreichen Schlag gegen die am Galgenberg liegenden Arbeitereinheiten. Noch am Abend kommt es mit ihren Vertretern in der Nähe des Hettstedter Bahnhofs zu Verhandlungen.
Naumburg. Oberbürgermeister, Kreisrat für die Einwohnerwehren in den Kreisen Naumburg Stadt, Land und Eckartsberga Jüttner, stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher Justizrat Wallach, Kommandeure der Reichswehrbrigade XVI, die Vorstände der drei sozialistischen Parteien, Mitglieder der Demokratischen Partei, Studienrat Doktor Kurt, Rechtsanwalt Herzfeld und die Vertreter der Gewerkschaften treffen zum Gespräch zusammen. Die Arbeiter übergeben ihre Forderungen, die nicht überliefert sind.
Generalmajor Hagenberg verkündet, dass die Reichswehrbrigade XVI treu zur Regierung steht und lediglich Ordnung und Sicherheit wiederherstellen will.
Treu zur Regierung? Hagenberg? Seine politischen Positionen mögen sich in der Zeit vom 13. bis 19. März verändert oder nicht verändert haben, zu Beginn des Putsches unterstützte er die "neue Regierung". Am 13. März 1920 ordnete er in Weimar an: "Die bisherige Reichsregierung ist zurückgetreten. Die Weisungen der jetzigen Reichsregierung [also Kapp-Lüttwitz] müssen im Interesse der Ordnung und Sicherheit unbedingt befolgt werden." (Brammer 1920, 38; Hagenberg 13.3.1920) Eine Lüge, denn die Reichsregierung war nicht "zurückgetreten".
Am 16. März 1920 gibt die Staatsregierung des Freistaates Sachsen-Weimar im Jenaer Volksblatt eine Erklärung gegen Hagenberg ab.
Vierundzwanzig Stunden später, das Scheitern des Putsches zeichnet sich deutlich ab, rudert Hagenberg zurück und beteuert, dass er hinter der gewählten Reichsregierung steht und die Landesregierung schützen werde.
"Dass die gesamte Reichswehr jetzt wieder zur rechtmässigen Regierung halten sollte, erhöhte mit Recht das Misstrauen der Arbeiter. Dieser Zwiespalt drohte," so Albert Grzesinski (2011, 146), Reichskommissar des Reichsabwicklungsamtes und später Präsident der preussischen Landespolizei, "nun erst recht zum Blutvergiessen zu führen, obwohl der Kapp-Putsch als solcher bereits zusammengebrochen war."
22. März, Montag zurück
Hohenmölsen. 2 000 Menschen folgen den Särgen der Kapp-Opfer.
 Eulau.
Ein Trupp der Naumburger Reichswehr durchsucht den kleinen Ort auf den
Saalehöhen nach Waffen und Munition. Während die Razzia zu ihrem
Ende kommt, reitet eine kleine Patrouille nach Goseck. Am Silbergrund
wird sie von Arbeitern beschossen. Bald darauf besetzen etwa 400 bis 500 Kampfgefährten
die Saalehöhen. Von Eulau eilt der gesamte "Durchsuchungstrupp"
zur Verstärkung herbei und liefert den Angreifern ein heftiges Gefecht.
Noch sind sie dem Gegner unterlegen, bis ihnen aus Naumburg Jäger
zu Rade und eine Artillerie Batterie beispringen. Die Arbeiter werden
zurückgeschlagen und von den Saalehöhen vertrieben.
Eulau.
Ein Trupp der Naumburger Reichswehr durchsucht den kleinen Ort auf den
Saalehöhen nach Waffen und Munition. Während die Razzia zu ihrem
Ende kommt, reitet eine kleine Patrouille nach Goseck. Am Silbergrund
wird sie von Arbeitern beschossen. Bald darauf besetzen etwa 400 bis 500 Kampfgefährten
die Saalehöhen. Von Eulau eilt der gesamte "Durchsuchungstrupp"
zur Verstärkung herbei und liefert den Angreifern ein heftiges Gefecht.
Noch sind sie dem Gegner unterlegen, bis ihnen aus Naumburg Jäger
zu Rade und eine Artillerie Batterie beispringen. Die Arbeiter werden
zurückgeschlagen und von den Saalehöhen vertrieben.
Halle. Gegen 9 Uhr vormittags setzen im Oberbergamt das Garnisonskommando und die revolutionären Kampfgruppen die Ausgleichsverhandlungen fort. Um 8.30 Uhr abends unterzeichnen sie eine Vereinbarung. Darin erklären sie: Die Reichswehrtruppen stehen auf dem Boden der verfassungsmäßigen Regierung. Bis 23. früh ziehen sich die Arbeiter zurück und geben ihre Waffen ab. Ruhe und Ordnung der Stadt schützt weiter die Reichswehr und unternimmt bis 27. März nichts gegen die Führer der revolutionären Kampftruppen, wenn sie wie vereinbart die Waffen abgeben. (Vgl. Schreiber 27f.)
|
"Es steht fest", bezeugt Walther Schreiber, "dass die Bewaffneten noch in der Nacht vom 22. zum 23. März der Vereinbarung gemäss abgezogen sind ...." Trotzdem spitzt sich die Lage an den nächsten zwei Tagen weiter zu, weil die Verhaftung der Arbeiter in rigoroser Weise fortgesetzt wird. Noch am Nachmittag des 22. März unternimmt die Reichswehr einen Überfall auf die Ammendorfer Front (vgl. Schunke 76). Das Garnisonskommando kümmert sich nicht um die getroffenen Abmachungen. Es rechtfertigt sich damit, dass das Abkommen nicht eingehalten worden sei. In Ammendorf schanzten am 23. März gegen 9 Uhr noch bewaffnete Arbeiter. "Tatsächlich hatte der in Ammendorf befehligende Führer der revolutionären Kampftruppe," erläutert Walter Schreiber (29-31), "der an den Verhandlungen teilgenommen hatte, es nicht für notwendig gehalten, seine Leute rechtzeitig zu informieren, so dass diese über die getroffenen Verabredungen am Vormittag des 23. März noch im unklaren waren …." Ausserdem sollen in Nietleben Waffen durch die Arbeiter verbracht worden sein. Andererseits haben gewisse Kreise der Reichswehr kein Interesse daran die Vereinbarung einzuhalten, beobachtet Walther Schreiber. Sie inszenieren Strafexpeditionen in die umliegenden Dörfer, Kriegs- und Standgerichte und eine Verhaftungswelle - den Weissen Terror (Joachim Schunke 77-87). Verdächtige kommen ins Verließ der Moritzburg (Halle). In der Reiterkaserne sind in der Zeit von 23. bis 25. März über hundert Arbeiter gefangen.
Der Gefreite Pohl erschießt am 24. März die vor ihn mit erhobenen Armen laufenden Gefangenen Gölicke und Koppensieker aus Wörmlitz (ebenda 81f.). Am 19. März wird der Sohn des Gutsbesitzers Walter aus der Gemeinde Kleinkugel und am 21. März der Rittergutsbesitzer Heinze ein Opfer der "Linksmorde beim Kapp-Putsch" (Gumbel 63).
Naumburg. "Die Landwirte werden aufgefordert, möglichst umgehend reichlich Lebensmittel, in erster Linie Getreide, dann aber auch Kartoffeln und andere Lebensmittel nach Naumburg zu senden." (Die Säuberung)
Einwohnerwehr und Sipo patrouillieren in der Stadt. Im Umkreis von 15 Kilometer säubert die Reichswehr Naumburg von "Feinden". ".... in den 14 Tagen waren ca. 200 - 300 Arbeiter verhaftet und in das Naumburger Gefängnis untergebracht." (Wallbaum 5) Darunter Neubert, Schuster und Heinrich.
Eine grosse Gewerkschaftsversammlung in der Reichskrone (Bild) fordert: "1. Aufhebung des verschärften Ausnahmezustandes. 2. Entwaffnung aller Personen ausser Polizei und Militär. 3. Freilassung aller Inhaftierten auch derjenigen die mit der Waffen betroffen sind [laut Original]. 4. Zahlung des Lohnes für die Streiktage."
Bürgermeister Karl Roloff versichert den Arbeitern:
Das Ausgehverbot wird gelockert und das Versammlungsverbot aufgehoben.
Für die Waffenabgabe wird die Frist bis zum 23. März, 6 Uhr nachmittags, verlängert. Namen sollen dabei nicht erfasst werden.
Militärbefehlshaber und Stadtverwaltung unterstützen das Verlangen nach einer Entschädigung für die Streiktage.
"Die infolge der Einstellung des Strassenbetriebes vom Leiter des Werkes ausgesprochene Entlassung der Strassenbahner soll als nicht geschehen gelten."
Gegen die Festgenommenen wird nicht standrechtlich oder vor ausserordentlichen Kriegsgerichten vorgegangen. Auf die Haft, hat jedoch die Militärbehörde und Stadtverwaltung, nach Roloff, keinen Einfluss. (Vgl. Forderungen)
Roloff geht damit durchaus auf die Arbeiter und Kapp-Gegner zu. Allerdings ist die Forderung nach Freilassung der politischen Gefangenen nicht erfüllt. "Trotz aller Bemühungen war es bisher nicht möglich," dokumentiert der Volksbote (Zeitz) am 22. April 1920, "den Inhaftierten die Freiheit wieder zurückzugeben, im Gegenteil: immer neue Verhaftungen erfolgen, immer neue Ermittlungen werden angestellt."
Übermorgen, so schlägt die Versammlung vor, soll die Arbeit wieder aufgenommen werden. Es kommt zur Abstimmung. Von den 1 541 Stimmberechtigten sind 1065 für und 367 Personen gegen die vorzeitige des Generalstreiks. 19 Stimmen gelten als ungültig.
Oberbürgermeister Dietrich und Militärbefehlshaber Wiesner schweigen weiterhin zu ihrer Verantwortung für den blutigen Dienstag (16.3.1920).
Major Wiesner befördert am 8. Juli 1939 anlässlich des Kommers der Offizierskameradschaft des ehemaligen 2. Thüringer Feldartillerie Regiments in der Hindenburg-Kaserne (Naumburg a.S.) Adolf Hitler zum "Oberbefehlshaber aller deutschen Herzen."
23. März, Dienstag zurück
Markröhlitz. Pödelist. Eine Gruppe der Reichswehr, die am Vortag bei Eulau im Gefecht mit den Arbeitern stand, dringt bis nach Markröhlitz vor, 9 Kilometer nordnordwestlich von Naumburg gelegen. Von hier hörte man Klagen über Plünderungen. Am Luftschiff, ein separat, etwa 500 Meter südlich der kleinen Ortschaft Pettstädt an der Kreuzung zweier Strassen gelegenes Gasthaus, gerät die Ordnungstruppe in den Kugelhagel. Ein Zeitbericht identifiziert die Rebellen als Rote Armee. Vier Tote und vier Verletzte fordert das Gefecht. Das Militär machte Gefangene. (Vgl. Bregler; Luftschiff; Pödelist)
Bad Kösen. Landrat Helmuth Karl Ernst Freiherr von Schele führt den neuen Bürgermeister Gerichtsassessor a. D. Hauptmann Dr. jur. Schubert, Jahrgang 1881, in sein Amt ein.
Naumburg. Der einfache Belagerungszustand trat bereits mit der Verordnung vom 13. Januar 1920 in Kraft. Heute verfügt der stellvertretende Führer der Reichswehrbrigade XVI und Militärbefehlshaber Oberst von Feldmann per Bekanntmachung den verschärften Belagerungszustand für die Militärbezirke Merseburg und Naumburg. Offiziere erhalten das Polizeirecht und die Vollmacht als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft tätig zu werden. Versammlungen von über zwanzig Personen unter freien Himmel sind verboten. Öffentliche Plätze und Straßen dürfen in der Zeit von 9 Uhr abends und bis 5 Uhr morgens nicht betreten werden. Es ist untersagt, durch Wort und Schrift zur Niederlegung der Arbeit oder zur Verweigerung der Wiederaufnahme der Arbeit aufzufordern. Jeder der bewaffnet angetroffen wird, läuft Gefahr erschossen zu werden. zurück Zur Reaktion der Naumburger ist nichts überliefert. Viele der Akteure sitzen im Gefängnis. Aber die Volksstimme (Magdeburg) meldet am 28. März:
"Daraufhin haben die Arbeiter in diesen Bezirken, besonders auf den Leuna-Werken, Freitag [27. März] morgen beschlossen, erneut in den Generalstreik zu treten. Indessen hat sich Oberpräsident Hörsing ins Mittel gelegt und den militärischen Befehlshaber zur Zurücknahme seiner Verordnung veranlasst, so dass neue Unruhen in diesem empfindlichen Gebiet nicht zu befürchten sind."
Oberst von Feldmann hebt die Zusätze am 27. März mit Wirkung zum 28. März 1920 wieder auf.
24. März, Mittwoch zurück
In Zeitz werden der Arbeiter Bergner und drei Soldaten gemeinsam zur Ruhe gebettet, dem Zug voran geht die Militärkapelle des Altenburger Regiments. Der Zeitzer Magistrat ist vollständig erschienen. Der vierten Soldaten, berichtet Adolf Leopoldt (1931, 52), überführte man in seine Heimat. Nach der Beerdigung gilt der Generalstreik als beendet.
Der Streik in Naumburg ist beendet. Jetzt heisst es: "Die Sicherheitswehr steht ebenso wie die Reichswehr auf dem Boden der Regierung Ebert-Bauer." Sie und die Sicherheitspolizei haben den Dienst in der Stadt aufgenommen, meldet das Naumburger Tageblatt.
Es beginnt die "Säuberung der Umgebung". Sie ist, teilt das Querfurter Tageblatt mit, "im Umkreis von 15 Kilometer von Feindefrei."
In der Stadtzeitung erscheint Die Vorgänge in Naumburg seit der Gegenrevolution. Einen Tag darauf folgt der Artikel: Der kommunistische Putsch in Bad Kösen.
25. März, Donnerstag zurück
Berlin. Das Reichskabinett dankt ab. Das neue Kabinett Müller tritt Ende März 1920 zur ersten Sitzung zusammen.
Halle. In einem Aufruf bringt die Streikleitung ihre Empörung über die "Bestialitäten entmenschlichter Militärs" zum Ausdruck. Erst wenn der letzte Verhaftete freigegeben ist, soll die Arbeit wieder aufgenommen werden. "Die Erregung über die Verhaftungen war so gross", beschreibt Walther Schreiber (32) die Lage, "dass z. B. die Eisenbahner, die am 24. März früh die Arbeit wieder aufgenommen hatten, ihre Arbeitsstelle alsbald wieder verliessen, und dass auch Arbeitgeber und Behörden dringend baten, diese Verhaftungen durch das Militär einstellen zu lassen." Es finden viele Streikversammlungen statt. Referenten der USPD drängen auf die Wiederaufnahme der Arbeit. Laut Joachim Schunke (1956, 83) lehnte dies die "Mehrheit der halleschen Arbeiter" ab.
Gegen Mittag erhält Zivilkommissar Walther Schreiber (Halle) vom Garnisonskommando in Halle endlich die Zusicherung, dass sämtliche zu Unrecht Verhafteten freigelassen worden sind.
Naumburg. Am Vormittag nehmen auf dem Exerzierplatz im Buchholz Reichswehr (Landesjägerkorps), Sipo (Sicherheitspolizei), Zeitfreiwillige und Einwohnerwehr Aufstellung. Oberst Feldmann, stellvertretender Kommandeur der Reichswehrbrigade XVI, schreitet die Front ab. Ein besserer Zählappell? Oder sollte die Truppe doch in Halle einmarschieren? Bei der anschliessenden Besichtigung der Naumburger Garnison führt Oberst Feldmann einen grossgeschossigen Nebelwerfer vor. Dann feuert er eine Wortsalve in die Untergebenen:
"Lasst uns klarwerden, Kameraden, worin unsere Aufgabe besteht, sowie darüber, was wir sollen und wollen: Mit Politik haben wir Soldaten nichts zu tun, rein gar nichts.
Nach dem von uns geleisteten Eide haben wir zu schützen die Verfassung, zu sorgen für Ruhe und Ordnung und zu gehorchen den Befehlen des Reichspräsidenten und unserer Vorgesetzten."
Die scheinheilige Propaganda, wonach die Politik außerhalb der soldatischen Sphäre liegt, ist nach allem was seit dem 13. März passiert ist völlig unglaubwürdig. Denn die "… hohen Kommandeure, die ihre Truppen Kapp und Lüttwitz zur Verfügung stellten", waren "sich immer im klaren darüber", stellt Heinz Hürten (1989, 25) heraus, "dass sie damit eine politische Entscheidung trafen, eine Entscheidung über die Verteilung von Macht zwischen konkurrierenden Gruppen, über die Realisierungschancen unterschiedlicher politischer Zielsetzungen."
26. März, Freitag zurück
Halle. Früh am Morgen setzt der Stadtverkehr ein. Bald beginnt die Berufsarbeit. Das Garnisonskommando löste durch die von ihr veranlasste Verhaftungswelle unter der Bevölkerung enorme Unruhe aus. Ebenso desavouierte bis 25. März der Streik das normale Leben. Den aktiven Kapp-Gegner drohte die strafrechtliche Verfolgung. Um wenigstens die schärfsten Konflikte beizulegen oder zu mildern, treffen die Vertreter von Behörden und Parteien, der Garnison und Gewerkschaften sowie Delegierte der revolutionären Kampftruppen im Rathaus von Halle zusammen. Ebenfalls anwesend ein Angesandter des Reichswehrministeriums in Berlin, General Lequis, und der Militärvertreter aus Halle und Naumburg. Die Verhandlungen leitet der Oberpräsident und Oberbefehlshaber der Provinz Sachsen Otto Hörsing (SPD). Man vereinbart alle Verhaftungen einzustellen, die aus Anlass der Unruhen in Haft genommenen freizulassen, die Zeitfreiwilligenverbände und Einwohnerwehren aufzulösen. Die Reichswehr soll in die Kasernen zurück. Gegen Kommandeure der Reichswehr, die nicht treu zur Regierung standen, soll die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren einleiten. Punkt 6 verlangt "Vollständige Amnestie für diejenigen, die sich an dem Kampfe gegen konterrevolutionäre Truppen beteiligt haben, sowie auch für politische Vergehen und Verbrechen aus der Zeit vor dem 12. März ... " (Düwell 29.2.1920) Die
Vereinbarung von Halle
gilt für den gesamten Regierungsbezirk Merseburg (einschliesslich Naumburg).
27. März, Sonnabend zurück
|
Inzwischen war die Reichswehr in die Stadt "zurückgekehrt".
Oberst von Feldmann, stellvertretender Führer der Reichswehrbrigade XVI, verfügt die Aufhebung des am 23. März 1920 erlassenen verschärften Ausnahmezustandes für die Wehrbezirke Naumburg und Merseburg. Aus Anlass seines Besuchs in der Naumburger Garnison, teilt das Naumburger Tageblatt mit: "Der Brigade sind von verschiedenen Seiten Liebesgaben für die Truppe überreicht worden".
SPD-Mitglied August Huth aus Bad Kösen, Fritz Voigt (Naumburg) oder Otto Grunert (SPD, Naumburg), alles Kapp-Gegner, erhalten für ihre politische Abwehr von Kapp-Lüttwitz keine Liebesgaben.
29. März zurück
Berlin. Reichsjustizminister Andreas Blunck, Deutsche Demokratische Partei, teilt der Nationalversammlung mit, dass gegen nachstehende Personen wegen Hochverrats Voruntersuchungen aufgenommen werden: Generallandschaftsdirektor Kapp, Regierungspräsident von Jagow, Major Pabst, Oberst Bauer, Doktor med. Georg Schiele aus Naumburg, Rechtsanwalt Bredereck, Unterstaatssekretär a. D. von Falkenhausen, Geheimrat Doye, Admiral von Levetzow, Major von Winterfeldt, Oberbürgermeister Lindemann, Regierungspräsident Pauli und Landrat von Löw. Nach dem Amnestiegesetz bleiben im Visier der Strafverfolgung: Kapp, Bauer, Schnitzler, Trebitzsch-Lincoln, Lüttwitz, Erhardt, Schiele, von Jagow und von Wangenheim.
Doktor Rudolf Heinze von der Deutschen Volkspartei (DVP) erklärte, dass seine Partei "unter allen Umständen auf dem Boden der Verfassung" stand und sie "unter allen Umständen einen Rechtsbruch" ablehnte. Geflissentlich übergeht er einen Aspekt ihrer öffentliche Erklärung vom 13. März, der "die schnellste Überleitung der heutigen provisorischen Regierung in eine gesetzmäßige" verlangte, was eine klare Unterstützung für Kapp-Lüttwitz bedeutete.
Bissig kommentiert Heinrich Ströbel (1920, 353): "Die reaktionären Parteien und Generäle hielten es für opportun, aus ihrer für die Putschisten so wohlwollenden Neutralität herauszutreten und sich mit treuherziger Unschuldsmiene wieder auf den Boden der Verfassung zu stellen. Mit dem innerlichen Gelöbnis: nächstes Mal wird das Ding besser gedreht."
Halle. Auf dem Gertraudenfriedhof werden die Opfer der Kämpfe in einem Massengrab beigesetzt. Erwin Könnemann und Hans-Joachim Krusch (1982, 194) beziffern die Zahl der Toten auf 104. Davon sind 64 Hallenser und zwölf Frauen.
Naumburg. Auf Veranlassung der Reichsregierung ziehen bayerische Truppen in die Kasernen ein. Ihr offizieller Auftrag lautet: Schutz der Eisenbahnanlagen und Brücken sowie von wichtigen Gebäuden.
|
Nach dem 21. März erfolgt die Stationierung der Sipo-Sammelgruppe Halle im Oberlandesgericht und in der Kadettenanstalt. Sie wird am 8. April 1920 abgezogen. Die erneute ständige Stationierung beginnt am 15. Mai 1920. Ihre Stärke beträgt am 1. Januar 1922: 8 Polizei-Offiziere, 1. und 2. Hundertschaft = 211 Beamte, Kraftfahrzeugzug = 7 Beamte, Nachrichtenabteilung = 12 Beamte.
Im Oktober 1921 wird die Sicherheitspolizei in Schutzpolizei umbenannt. Laut Rundverfügung des Ministeriums des Inneren erfolgt am 6. Juni 1926 ihre Auflösung. (Vgl. Über den Aufbau 1926)
19. April zurück
Oberbürgermeister Arthur Dietrich stellt die Sicherheitslage nicht zufrieden. Er warnt: "Eine Anziehungskraft ist für aufrührerische Elemente das Artilleriedepot, mit dessen erheblichen Waffen- und Munitionsvorräten eine rote Armee von 4 000 Mann ausgerüstet werden kann …" Die grosse Zahl der Villen bildet einen Anziehungspunkt für verbrecherisches Gesindel, das politische Unruhen zur Plünderung auszunutzen bestrebt ist.
Noch ist keine Ruhe eingezogen, wenn man der Presse und den amtlichen Einschätzungen Glauben kann. Die Kommunisten, behauptet im April 1920 die Deutsche Zeitung und nennt unter anderen die Städte Naumburg und Zeitz, wollten durch einen Aufstand Mitteldeutschland und Thüringen erobern.
Allerdings war ein erst kürzlich angekündigter Kommunisten-Putsch im 100 Kilometer westlich von der Saalestadt gelegenen Sonderhausen nichts anderes als "ein inszenierter Schwindel der reaktionären Spitzelzentrale in Naumburg", der von einem Leutnant Schaum in Verbindung mit einer Frau Schröder-Mahnke bis in alle Einzelheiten vorbereitet worden war, berichtete am 2. Juni 1920 die sozialdemokratische Voralberger Wacht.
20. April zurück
In Naumburg tagt die Stadtverordnetensitzung. Auf der Tagesordnung steht die Auswertung der März-Ereignisse. Zum Gedenken an die Toten erheben sich alle von den Plätzen. Aber "ohne dass wir uns dabei anmassen wollen zu entscheiden," wie der Versammlungsleiter Justizrat Ludwig Wallach nicht vergisst einzuschränken, "inwieweit sie im Recht oder Unrecht gewesen sind." Oberbürgermeister Arthur Dietrich trägt den Bericht zu den Kapp-Tagen vor. Dagegen "liefen nun fast sämtliche Mitglieder der mehrheitssozialistischen Fraktion Sturm" und nannten für die Kampfhandlungen folgende Ursachen: (1.) Oberbürgermeister und Magistrat unterließen es, sich öffentlich von Kapp zu distanzieren. (2.) Sie versetzten das Rathaus "unnötiger Weise in den Kriegszustand" (Robert Manthey, SPD). (3.) Die Truppenparade, gemeint ist der Einsatz der Reichswehr am 16. März, hätten der Oberbürgermeister Dietrich und Magistrat verhindern müssen, statt ihn zu begrüssen. (4.) Obwohl es ein ausschlaggebendes Moment für die Auslösung der Kämpfe in Bad Kösen und Naumburg am 19. März war, berührt Arthur Dietrich in seinem April-Bericht den Einsatz der Naumburger Truppen in Weimar und die (zumindest zeitweilige) Unterstützung von Kapp-Lüttwitz durch Generalmajor Hagenberg, Reichswehrbrigade 16, nicht. (5.) "Die Absicht der radikalen Elemente, die Räterepublik auszurichten," so schätzt es Arthur Dietrich ein, "sei schon an diesem Tage in Erscheinung getreten." Damit meint er wahrscheinlich die Haltung der Arbeiter zu Max Jüttner bei den Verhandlungen am Sonntagnachmittag (14.3.) im Rathaus und ihre Selbstbewaffnung am 17. und 18. März. Diese bedeutet aber keine politische Radikalisierung, sondern ist eine Reaktion auf den blutigen Dienstag (16.3.). Die Tendenz im Aktionsausschuss war eindeutig eine andere. Allerdings versteht es der Oberbürgermeister gut, die politischen Arabesken bei den Putsch-Gegnern zu nutzen, um seine Option für Kapp zu maskieren. Gegen ihn wird ein Disziplinarverfahren eröffnet. (Die Archivunterlagen dazu waren nicht auffindbar beziehungsweise nicht einsehbar.)
Im Gefängnis zurück
Bei den Aktionen und Kämpfen gegen Kapp-Lüttwitz in Naumburg, Bad Kösen, Weißenfels und Zeitz dominieren klar die Handarbeiter (blue collar worker). Nach dem Ende der Kämpfe nehmen Sipo, Reichswehr und Polizei viele Verhaftungen vor. Das Naumburger Gefängnis versinnlicht die grosse Ungerechtigkeit, die den Männern vom Aktionsausschuss nach dem Kapp-Putsch wiederfuhr.
Am 30. August 1921, vier Tage vorher war Matthias Erzberger bei Bad Griesbach im Schwarzwald ermordet worden, ruft Otto Grunert, Vorsitzender der SPD-Ortsgruppe Naumburg, den Teilnehmern der Protestkundgebung auf dem Kaiser-Friedrich-Platz (Heinrich-von-Stephan-Platz) zu:
Die "Kapp-Verbrechen seien nicht verurteilt, aber Tausende von Arbeitern sässen im Gefängnis die doch nur für ihr Menschenrecht gekämpft hatten."
Unter ihnen Leopold Heinrich, der nach dem Putsch ein Monat im Gefängnis zubrachte. Über die Verpflegung sagte er, es sei ein Hundefrass. Dafür verurteilte ihn das Gericht auf Strafantrag der Gefängnisleitung zu 500 Mark Geldstrafe.
|
Zu den Vorfällen im Naumburger Gefängnis stellt am 10. April 1920 die in Zeitz tagende Außerordentliche Generalversammlung der USPD für den Naumburg-Weißenfels-Zeitzer Kreis fest:
"Die Kreisversammlung nimmt mit Entrüstung Kenntnis von der bestialischen Ermordung und Misshandlung unserer Genossen aus Anlass der Niederschlagung des Kapp-Putsches in Naumburg. Sie fordert mit aller Entschiedenheit scharfe Bestrafung der Lüttwitz-Söldner, die sich in dieser Weise vergangen haben ..."
"Von Familienangehörigen der [in Naumburg] Inhaftierten wird berichtet," steht am 22. April 1920 im Volksbote(n) (Zeitz), "daß sie in der Nacht vom 16. zum 17. April 1920 von den Wachmannschaften fürchterlich geschlagen worden sein. Die feigen Halunken in Reichswehruniform nahmen Rache für die vernichtende Kritik, die eine Massenversammlung am Abend des 16. April gegen sie geübt."
"Gerade im Bereiche der Naumburger Justizbehörden sind Misshandlungen der allerschlimmsten, allergemeinsten Art gegen verhaftete Arbeiter vorgekommen, über die mir eine Reihe von Aussagen vorliegen," teilt in der 13. Sitzung des Deutschen Reichstages am 29. Juli 1920 der Abgeordnete Bernhard Düwell mit. "Die Naumburger Gerichtsbehörden müssen davon wissen; denn diese Misshandlungen sind im Naumburger Untersuchungsgefängnis und im Gerichtsgebäude passiert, sie waren deshalb möglich, weil man der Sicherheitswehr und der Naumburger Einwohnerwehr, die während der kritischen Kapp-Tage die Gefängnisse bewachten, die Zellen der Inhaftierten geöffnet hat. Trotzdem werden all diese Misshandlungen von den Naumburger Behörden mit frecher Stirn abgeleugnet." Besonders empörte folgendes Ereignis: "Es handelt sich um einen jungen Arbeiter, der mit einer schweren Handverletzung, die bereits verbunden war, als Untersuchungsgefangener in das Naumburger Untersuchungsgefängnis eingeliefert wurde. In diesem Untersuchungsgefängnis wurde er von der Sicherheitspolizei in der infamsten Art und Weise mit einer Rohstange solange auf die Wunde geschlagen, die er an der Hand hatte, bis er bewusstlos zusammenbrach." "…. Ich habe hier noch eine Reihe andere Aussagen", schiebt Bernhard Düwell nach.
Die Entrüstung über die Misshandlungen und Vorkommnisse im Naumburger Gefängnis macht sich am 21. Juli 1920 in einer grossen Protestversammlung in der Reichskrone (Naumburg) Luft. Referent Bernhard Düwell gibt einen ausführlichen Bericht zur Tätigkeit der Naumburger Klassenjustiz. Darin geisselt er
"die entsetzlichen Schandtaten Naumburger Truppenteile und Offiziere gegen unbewaffnete Bürger während der Kapptage." (Justiz)
Versammlungsteilnehmer Walter Fieker (21.7.1920) schimpft "in verletzender Weise auf die Naumburger Justiz", was er zu sagen hatte, war wirklich nicht schmeichelhaft:
"Einer der Herren vom Gericht hätte erklärt, dass alle Gewerkschafter an die Wand gestellt werden müssten. Auch sei von einem der Gerichtsherren gesagt worden, er betrachte die Arbeiter als fressende Tiere."
Am 18. August 1920 gibt der Oberstaatsanwalt beim Landgericht Naumburg gegenüber dem Generalstaatsanwalt folgende Gegendarstellung: Walter Fieker (KPD) sei bei seiner Vernehmung im Naumburger Gefängnis zuvorkommend behandelt worden; die Behauptung, die Gewerkschafter müssen an die Wand gestellt werden, ist erfunden; von gleicher Herkunft sind die Worte des betreffenden Gerichtsherren, der gesagt haben soll, Arbeiter sind fressende Tiere.
Der Oberstaatsanwalt konzentriert sich auf die Wahrung der allgemeinen Normen des Anstandes. Schmerzlich vernachlässigt er den Umstand, dass Häftlinge misshandelt wurden. Es war die "Naumburger Einwohnerwehr, die während der kritischen Kapp-Tage die Gefängnisse bewachte". Die Aussage zum Umgang mit den Gewerkschaftsmitgliedern und über die fressenden Tiere können nicht mehr überprüft werden. Gefangene und Angeklagte berichten aber mehrfach, dass die Naumburger Justiz sie in wilhelminischer Manier behandelte.
An die Untaten erinnert Adolf Leopoldt 1931 in der Roten Chronik (152):
„Und im Gefängnis in Naumburg wurden viele der Verhafteten schwer misshandelt, an ihnen ließ man den Ärger über die verunglückte [Putsch-] Aktion aus.“
|
- März / April 1920 -
|
|||
|
Entlassen**
|
Entlassen**
|
||
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
23.4.1920
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
23.4.1920
|
|
*
|
|
|
|
24.4.1920
|
|
23.4.1920
|
|
24.4.1920
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
24.4.1920
|
|
*
|
|
24.4.1920
|
|
23.4.1920
|
|
*
|
|
23.4.1920
|
|
24.4.1920
|
|
*
|
|
23.4.1920
|
|
24.4.1920
|
|
24.4.1920
|
|
24.4.1920
|
|
*
|
|
23.4.1920
|
|
*
|
|
23.4.1920
|
|
23.4.1920
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
keine
Amnestie
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
*
|
|
23.4.1920
|
|
23.4.1920
|
|
23.4.1920
|
|
*
|
|
23.4.1920
|
|
*
|
|
23.4.1920
|
|
23.4.1920
|
|
keine
Amnestie
|
|
*
|
|
*
|
|
23.4.1920
|
|
Amnestie
|
|
Amnestie
|
|
*
|
|
25.4.1920
|
|
23.4.1920
|
|
24.4.1920
|
|
24.4.1920
|
|
23.4.1920
|
|
23.4.1920
|
|
Amnestie
|
|
*
|
||
|
|||
Otto Hörsing (1874-1937) bemüht sich um die Freilassung der Kämpfer des Aktions-Ausschusses. Am 15. April 1920 sendet er ein Telegramm an die Staatsanwaltschaft Naumburg (siehe unten) und weist die Freilassung von sechzig Kapp-Putsch-Kämpfern aus dem Gefängnis Naumburg an.
 |
|
Telegramm von Otto Hörsing (1874-1937) an die Staatsanwaltschaft Naumburg vom 15. April 1920. Quelle: Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. C 141 Naumburg. Dokument im Schwarzweiss-Umkehrverfahren digital bearbeitet. Keine Veränderungen der semantischen Bildinformationen vorgenommen. Otto Hörsing, SPD, seit 1924 Vorsitzender des Reichsbanners. 1932 schliesst ihn die Partei aus. Siehe auch:
Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik - Das Kabinett
Fehrenbach, Band 1, Dokumente Nr. 208: Aufruf des Oberpräsidenten
Hörsing vom 16. März 1921 zum Einsatz der Schutzpolizei
im sächsischen Industrierevier, Seite 584-585. Brief von Paul Levi (1883-1930) an Wladimir Iljitsch Lenin (1870-1924) vom 27. März 1921. |
Damit ist der Reichsminister für Justiz überhaupt nicht einverstanden. Vor der Nationalversammlung äussert er am 14. April 1920:
"Ich halte es, und ganz besonders unter den gegenwärtigen Verhältnissen überhaupt nicht für meine Aufgabe, dafür zu sorgen, Verbrecher der Bestrafung zu entziehen, sondern sie nach Möglichkeit der Bestrafung zuzuführen."
|
Tatsächlich muss es zwischen Hörsing und dem Minister (vgl. Justizminister) über die Freilassung der Gefangenen zu ernsten Differenzen gekommen sein, worauf folgendes Telegramm des Reichsjustizministeriums vom 12. Mai 1920 hinweist: An Hörsing ist nochmals die Weisung ergangen, sich nicht in die Gerichtsentscheidungen einzumischen, weil dies den ordentlichen Gang der Rechtspflege gefährdet. Sollte der Regierungskommissar auch jetzt noch Anordnungen treffen, die in die Gerichte eingreifen, bittet der Minister um Nachricht.
Der Zivilkommissar für den Regierungsbezirk Merseburg Krüger teilt am 24. April 1920 dem Staatsanwalt in Naumburg mit:
"Fast alle diese Leute sind verheiratet und haben eine Anzahl von Kindern und festen Wohnsitz, so dass sie sehr wohl vernommen werden können ohne in Haft behalten zu werden, zumal all den Familien der Ernährer genommen ist."
Noch immer sind im Naumburger Gefängnis viele Arbeiter inhaftiert. Das könnte eine Quelle von Unruhe und Protest sein, befürchtet Bürgermeister Karl Roloff. Am 21. März 1921 informiert er den Regierungspräsidenten von Merseburg:
„Wir weisen ergebenst daraufhin, dass allein für die Sicherung des hiesigen Gerichtsgefängnisses, welches augenblicklich mit über 300 Gefangenen belegt ist, unbedingt eine Hundertschaft erforderlich ist. Unter den Inhaftierten befinden sich noch sehr viele Personen, die aus Anlass der März-Unruhen des vergangenen Jahres mit hohen Strafen belegt worden sind, oder doch noch einer schweren Bestrafung entgegen sehen. Das hiesige Gefängnis ist aus diesem Grunde weiten Kreisen ein willkommener Gegenstand zur Aufreizung und wiederholt ist gedroht worden, die Gefangenen zu befreien.“
Naumburger
Gerichte haben
in der tollsten Weise das Recht gebeugt zurück
Im April 1920 mahnt die Tribüne (Erfurt): "Durch die bisher in Naumburg verhandelten Prozesse, z.B. Kilian Prozess oder Ferchlandt-Prozess und viele andere, ist Naumburg in ganz Deutschland als ein Hauptstützpunkt der Reaktion bekannt geworden."
Seine Erfahrungen mit dem Naumburger Militär und der Rechtspflege teilt der Volksbote (Zeitz) am 22. April 1920 mit:
"Die Stadt Naumburg a. d. Saale ist der Sitz der 16. Reichswehrbrigade und zugleich das Zentrum der reaktionären Clique in Mitteldeutschland." "Die Naumburger Staatsanwaltschaft zeichnet sich in diesem Kreise ganz besonders aus."
"In Kösen hat der Polizeigewaltige Riedel", moniert SPD-Mitglied August Huth aus Bad Kösen am 17. April 1920, "der sich öffentlich für Kapp-Lüttwitz gestellt hat, den Polizeisergeanten Marx, der sich auf Erbert-Bauer gestellt hat, dieser Tage aus dem Polizeidienst entlassen. Prachtvolle Zustände! Die treuen Anhänger von Ebert-Bauer fliegen. Weiter kritisiert er die Naumburger Staatsanwaltschaft. Im Juni 1920 dringt die mangelnde Objektivität der Naumburger Gerichte bis zur Vorarlberger Wacht.
Die Kapp-Gegner sehen im Naumburger Schwurgericht eine Institution des Klassenrechts.
 |
|
Kaiser-Wilhelm-Platz
mit Blick zum Schwurgerichtsgebäude (Etwa um 1900, Bild digital
bearbeitet.)
|
 |
|
Schwurgerichtsgebäude
(um 1900), Richtfest 18. August 1858
|
 |
|
Das
alte Schwurgerichtsgebäude als Teil der Justizvollzugsanstalt
Naumburg (2006)
|
Nach Beendigung der Kämpfe kommen viele Zivilisten wegen unerlaubten Waffenbesitz, Zusammenrottung oder Hausfriedensbruch vor Gericht.
Doch "…. die ganze Art Zeugenvernehmung, wie sie der Vorsitzende der Naumburger Strafkammer im Prozess gegen die wegen unbefugten Waffentragens und Landfriedensbruches angeklagten Arbeiter vornahm," verärgert den Reichstagsabgeordneten Bernhard Düwell (29. Juli 1920). Sie "zeigt ganz deutlich, dass die Naumburger Richter unter allen Umständen ein Urteil erzielen wollten. Zu diesem Zwecke haben sie, hat besonders der Staatsanwaltschaftsrat Hardt, der die Anklage vertrat, mit allen Mitteln dem Gericht, den Richtern und Geschworenen, die Ueberzeugung zu suggerieren versucht, dass man es bei den angeklagten Arbeitern mit ganz gefährlichen, verbrecherischen Subjekten zu tun habe."
Der Zivilkommissar für den Bezirk Merseburg Krüger protestiert am 24. April 1920 bei der Staatsanwaltschaft in Naumburg:
"Erneut gehen mir Klagen darüber zu, das Leute, sie sich anlässlich Putschtage an den Kämpfen beteiligt haben, noch in Haft sind oder noch in Haft genommen werden. Ich lehne es selbstverständlich ab, der Staatsanwaltschaft das Ansinnen zu stellen, Leute die gemeiner Verbrechen beschuldigt werden, die Stange zu halten."
Krüger sind eine Reihe von Personen namhaft gemacht worden, "die nur leitende Arbeiten verrichteten oder in den guten Glauben für die Verfassung gekämpft zu haben". "Meine Aufgabe ist es", legt er der Naumburger Staatsanwaltschaft dar, "für Ruhe und Ordnung zu sorgen, erblicke ich auch darin, Beunruhigungen, ohne übertriebene Ängstlichkeit zu vermeiden. Die Verhaftungen lösen aber meist auf den Industriewerken, wo die Leute beschäftigt sind, solche Wirkungen aus. Ich ersuche daher ergebenst alle die Fälle eingehend zu prüfen und die Haftentlassung herbeizuführen."
Über die Rechtmäßigkeit des Handelns der Kapp-Gegner und die rechtspolitischen Konsequenzen geraten die Parteien in heftigen Streit. Im Rathaus von Halle treten am 26. März die politischen Verantwortungsträger zusammen. Dabei ein Vertreter Reichsministeriums des Reichskanzlers, ein Vertreter des Reichswehrministeriums in Berlin, des Generals Lequis, und Militärvertreter aus Halle und Naumburg. Sie schliessen ein Abkommen, dass zum Abbruch der Kämpfe in Mitteldeutschland führt. Punkt 6 lautet: "Vollständige Amnestie für diejenigen, die sich an dem Kampfe gegen die konterrevolutionäre Truppen beteiligt haben, sowie auch für politische Vergehen und Verbrechen aus der Zeit vor dem 12. März 1920: Oberpräsident Hörsing erklärt, voll und ganz auf dem Boden dieser Forderung zu stehen."
Die Straffreiheit für die Kapp-Gegner, darauf weist Bernhard Düwell am 29. Juli 1920 in seiner Reichstagsrede hin, ist nicht eine Frage der Gnade, sondern eine Selbstverständlichkeit zur "Wiederherstellung des geschändeten Rechts in Deutschland".
In der Praxis war das nicht einfach zu bewerkstelligen. Obwohl der Oberpräsident der Provinz Sachen Otto Hörsing und die Reichsregierung dieses Abkommen anerkennen, trägt es keinen Gesetzescharakter, weshalb es durch die Gerichte nicht problemlos anwendbar war. Daraus erwuchsen weitere Konflikte, worauf Bernhard Düwell hinweist: "Die Naumburger Behörden haben einfach erklärt, das Hallesche Abkommen gehe sie gar nichts an, sie seien vollkommen unabhängig von der Regierung." So "liessen die Naumburger Justizbehörden bisher eine große Zahl von Arbeitern hinter Schloss und Riegel stecken." Zum anderen stellte sich die Führung der Reichswehrbrigade 16, wie dem Schreiben vom 20. April 1920 an den Ersten Staatsanwalt Drygalski in Naumburg zu entnehmen ist, auf den Standpunkt, dass das Abkommen von Halle durch die Arbeiter [in Halle] gebrochen wurde und deshalb bedeutungslos ist.
Das ruft bei nicht wenigen Kapp-Gegnern schwere politische Verstörungen hervor. Sie fürchten um ihre Freiheit und antizipieren den wirtschaftlichen Niedergang. Im April 1921 verurteilte das Naumburger Sondergericht den Bergarbeiter Max Sauer aus Oberröblingen (bei Sangerhausen) zu 15 Jahren Zuchthaus, weil er einen Aktionsausschuss gegründet hatte und die Bürger im Alter von 18 bis 40 Jahren im Rahmen der Verkündung der allgemeinen Wehrpflicht zu den Waffen gerufen hatte. Vielerorts erregt das Vorgehen der Naumburger Staatsanwaltschaft Unmut. Am 16. Juni 1920 intervenieren der Deutsche Bergarbeiterverband (Max Köhler), Deutsche Metallarbeiterverband (Kittelmann), Maschinen- und Heizer Verband (Drygalla), Vorsitzende des USPD-Ortsvereins, Vertrauensmann Deutscher Landarbeiter (Waitz) und das Gewerkschaftskartell (Günther) aus dem 24 Kilometer nördlich von Naumburg gelegenen Mücheln beim Oberpräsidenten der Provinz Sachsen Otto Hörsing. Sie klagen darüber, dass der Bergmann Karl Schneider verhaftet wurde, weil er in Branderoda die Einwohnerwehr mit entwaffnet hat. Die Festnahme ruft große Empörung hervor. "Gegen das Vorgehen der Naumburger Staatsanwaltschaft" legen sie "den schärfsten Protest" ein. Auf diese Weise trägt die "Naumburger Staatsanwaltschaft, in die hiesige Arbeiterschaft dauernde Unruhe" hinein. "Unterzeichnete Verbände lehnen die Verantwortung ab, wenn aus der systematisch geschaffenen Kampfstimmung in der Arbeiterschaft ein allgemeiner Generalstreik sich entwickeln wird". Die Briefschreiber bitten Otto Hörsing um die Reglung dieser Angelegenheit. Zwei Tage später ersucht der Oberpräsident den Generalstaatsanwalt von Naumburg, "falls Schneider kein gemeines Verbrechen begangen" hat, aus der Haft zu entlassen.
Nach dem Scheitern des Putsches werden die Naumburger Gerichte und Behörden nicht müde zu behaupten, dass sie der Regierung Ebert-Bauer immer treu ergeben waren. Zum Beispiel sagt der erste Staatsanwalt von Naumburg am 14. April 1920:
"Bemerkt sei, dass auch weder von Seiten der Einwohnerwehr noch von Seiten irgendeiner Behörde in Naumburg eine Parteinahme für Kapp=Lüttwitz erfolgt ist." (Notizen)
Major Wiesner äussert im Aufruhr-Prozess am 3. August 1920 vor dem Schwurgericht:
"In Naumburg ist nichts für Kapp geschehen."
Exakt diese Auffassung vertritt (auch) Oberstaatsanwalt Hardt vom Landgericht Naumburg im Brief vom 18. August 1920 an den Generalstaatsanwalt. Danach standen die in Naumburg stationierten Reichswehrtruppen auf Seiten der Regierung Ebert-Bauer und handelten rechtmässig. Wo hingegen die Aktionen der Anti-Kapp-Kämpfer unrechtmässig waren, weshalb sie damit rechnen mussten, niedergeschossen zu werden. Wörtlich:
"Die bewaffneten Arbeiter, welche am 19ten März 1920 in Kösen der aus Weimar kommenden Reichswehr den Weg nach Naumburg zu verlegen suchten, kämpften nicht zum Schutze der Regierung Ebert-Bauer, sondern gegen Truppen, die, wie überall öffentlich bekannt gemacht war, auf dem Boden der Regierung Ebert-Bauer standen. Die Truppe hatte dienstlichen Befehl, jeden Aufrührer, der mit der Waffe in der Hand im Kampfe gegen sie stand, zu erschiessen."
Die Konsequenzen dieser Naumburger Rechtsauffassung trägt am 29. Juli 1920 der Abgeordnete Bernhard Düwell dem Reichstag vor:
"Indem das Naumburger Gericht die Beweisführung darüber, dass das Militär in Naumburg, Weißenfels, Halle und so weiter kapistisch gewesen sei, abschnitt, indem es verhinderte, dass der wirkliche Grund, aus dem heraus die Arbeiter zu den Waffen gegriffen hatten, herauskam, ein Grund, der zum Freispruch führen musste, hat es in der tollsten Weise das Recht gebeugt."
"Wir verlangen, dass wegen der Spruchpraxis, die in den letzten Monaten vom Naumburger und Hallenser Schwurgericht und den dortigen Strafkammern gegen die Arbeiterschaft Mitteldeutschlands geübt worden ist, allerstrengste Untersuchung und Bestrafung derjenigen vorgenommen wird, die erwiesenermassen jede Objektivität in ihren richterlichen Handlungen haben vermissen lassen."
Wilhelm Koenen (1886-1963) geht in der Debatte zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses über die Zustände in den Strafanstalten im November 1921 im Reichstag noch weiter und fordert: "Er muss mit Jagow, mit [Georg] Schiele, mit Traub, und wie sie alle heissen, auf die Anklagebank und darf nicht Oberstaatsanwalt spielen! Wir haben in den Kapp-Tagen und vorher die Erfahrung gemacht, dass
dies Naumburg eine echte Kapp-Stadt.
ist. Die Mitteldeutschen Arbeiter nennen es nicht anders." (Koenen 1921)
In Erinnerung bleibt:
- Georg Schiele
(Naumburg) schickte sich an, als Wirtschaftsminister im Kabinett Kapp-Lüttwitz
Verfassungsbruch zu begehen.
- Generalmajor Hagenberg
stand in Weimar auf Seiten der Putschisten. Naumburger Truppen unterstützten
ihn am 15. März.
- Die angebliche
Regierungstreue der Naumburger Truppen, die die Gerichte der
Stadt oft ihren Entscheidungen zugrunde legten, war eine Lüge.
- Max Jüttner
(Naumburg), Kreisrat für die Einwohnerwehren der Kreise Naumburg
Stadt, Land und Eckartsberga, pflegte Kontakte zu den Umstürzlern.
- Der Waffengebrauch
am 16. März durch die Reichswehr auf dem Markt war verantwortungslos
und zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit nicht erforderlich.
- Die Staatsanwaltschaft des Landgerichts Naumburg deckte die Gewaltexzesse an den festgenommenen Kämpfern im Gefängnis und an anderen Orten.
Hunderte Bürger bezahlen ihren Einsatz für die rechtmässige Regierung mit dem Verlust der Freiheit und schweren persönlichen wirtschaftlichen Nachteilen. Darüber kann man im politischen Berlin nicht ohne Weiteres hinwegsehen. Aus dem Justizministerium (Berlin, Wilhelmstraße 65) ergeht am 19. April 1920 an die örtlichen Organe der Rechtspflege eine Weisung zur Entschärfung des Konflikts. Der Justizminister insistiert darauf, dass
"ein subjektives Bewusstsein von der Rechtswidrigkeit, selbst wenn nach dem objektiven Tatbestand eine strafbare Handlung feststellbar,"
bei den Anti-Kapp-Aktivisten nicht vorliegt. Er bittet die Beamten der Staatsanwaltschaften, dies in Betracht zu ziehen. Wenn eine "Außerverfolgungsetzung" nicht möglich ist, so soll eine Information an Minister Hugo am Zehnhof ergehen. Am 24. April 1920 ordnet Oberpräsident Hörsing aus Magdeburg als Regierungskommissar an, Personen die im Zusammenhang mit dem Putsch im März in Haft genommen wurden, ausser im Fall von Hochverrat, Mord, Totschlag, Brandstiftung, Plünderung oder Diebstahl, auf freien Fuss zu setzen.
Rechtssicherheit
als eine
notwendige Vorbedingung für die Freiheit
Arthur Graf von Posadowsky-Wehner stellte sich im März 1920 gegen den Putsch von Kapp-Lüttwitz. Am 16. April 1920 meldete die "Freiheit" (Berlin), dass der Staatssekretär a.D. den Merseburger Verband der Deutschnationalen Partei (DNVP) gebeten hat, von seiner Wiederaufstellung als Kandidat zur Nationalversammlung Abstand zu nehmen. Offenbar distanzierte er sich nicht nur von den Handlungen und der Haltungen führender DNVP-Mitglieder im Kapp-Putsch, sondern zieht die Konsequenzen aus einen für Staat und Gesellschaft nicht vorteilhaften politischen Kurs, der seinen rechtspolitischen Überzeugungen grundsätzlich widersprach. Zunächst ist dies seine unmittelbare Antwort auf Ereignisse vom 13. März 1920 in Berlin. Niemals wird ihn das die streng nationale Familie verzeihen.
Rechtssicherheit begreift der Graf als eine notwendige Vorbedingung für die Freiheit im bürgerlichen und öffentlichen Leben. Die strenge Achtung des Rechtskreises der anderen, erfordert die Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstbeschränkung, erklärt er in "Volk und Regierung im neuen Reich" (63). Wo dies nicht streng geachtet, "muss die verfassungsmäßige versprochene Freiheit schließlich zur inneren Zerrüttung des Volkslebens und Staates führen". Daran schliesst sich sein rechtspolitisches Axiom:
Rechtssicherheit für alle Bürger. Verteilung und Verwaltung der politischen Macht unter Einbeziehung aller Bürger.
Folgen - Schwierigkeiten - Rückblick zurück
Verantwortlich waren die Regierung und Mehrheitssozialisten
".... es steht unzweifelhaft fest," resümiert der Abgeordnete des preussischen Landtages und Zivilkommissar für Halle Doktor Walther Schreiber (1920, 2), "dass massgebende Führer der Deutschnationalen Volkspartei, bei dem Staatsstreich ihre Hand im Spiele gehabt haben und dass ein nicht unwesentlicher Teil der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) den Umsturz freudig begrüßt und verteidigt hat. Oberst Bauer, der Abgeordnete Traub und Dr. Schiele, Naumburg, der Kandidat der Deutschnationalen für die künftigen Wahlen in unserem Bezirk, sind die Spiessgesellen Kapps gewesen." Grosse Teile der Öffentlichkeit widerspiegeln das aber deutlich anders. Denn es gelang den Deutschnationalen und Völkischen, die Regierung und Mehrheitssozialisten in weiten Kreisen der Bevölkerung allein für den Putsch verantwortlich zu machen. (Vgl. Striesow 1980, 198) Ihrerseits leugnete sie jegliches Vorwissen für den Putsch und verbarg geschickt das wahre Ausmaß der Beteiligung ihrer Parteimitglieder.
Obwohl Paul Lettow-Vorbeck (1870-1964) militärisch aktiv am Kapp-Putsch beteiligt war, tat dies seinem Ansehen als Löwe von Afrika in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik Deutschland keinen Abbruch.
SPD Wehrpolitik gescheitert
Gustav Noske musste als Reichswehrminister zurücktreten. Otto Wels will den Posten auf Grund seiner Erfahrungen als Stadtkommandant von Berlin 1918 nicht übernehmen. Der SPD gelingt es nicht, einen anderen Kandidaten aufzustellen. Ihr Einfluss auf die Reichswehr geht verloren. Mit dem Einsatz der Baltikumer, Reichswehr und Freikorps für die nationale Sicherheit kam der alte Geist des Militarismus. Und vom Reichswehrminister hängt es ab, erkannte Heinrich Ströbel (1920, 354) gleich nach dem Putsch, "ob die Republik sich künftig ruhig entwickeln kann." Das wird sie nicht, wie der Deutsche Tag 1924 in Halle zeigt. Ein Staat im Staate, wie es der Reichswehr oft nachgesagt, war sie andererseits nicht. Mehrfach wirkte sie mit, etwa als Müller, Brüning oder von Papen kippten. Bürgerliche Gewalten teilten die Macht mit ihr. "Einzigartig ist die Lethargie, mit der die deutschen Linksparteien" die Generalswirtschaft "hinnehmen". "Die gelernten Marxisten zucken die Achseln", registriert Carl von Ossietzky (1932, 282), und sagen: "Das ist halt der Klassenstaat!"
Noskes Wehrpolitik leitet nicht nur den militärpolitischen Bankrott der SPD-Führung ein, sondern belastete ebenso die SPD-Basis in Naumburg mit einer schweren politisch-moralischen Hypothek, die sie nicht abtragen konnte.
Ende März 1920 tritt das Reichskabinett zurück. Der neue Reichskanzler Hermann Müller (1876-1931) bildet es um. Wiederaufbauminister Otto Gessler (1875-1955) übernimmt das Reichswehrministerium, Hapag Direktor Wilhelm Cuno (1876-1933) das Finanzministerium und Doktor Joseph Wirth (1879-1956) das Schatzministerium. In der Erklärung der Regierung fordert Hermann Müller: "Wer mit Kapp und Genossen, sei es bei den Behörden oder in der Reichswehr, gemeinsame Sache gemacht hat, muss verschwinden."
Reichstagswahlen am 6. Juni 1920
Der Regierungsbezirk Merseburg, "die Hochburgen der Unabhängigen Sozialdemokraten waren", "werden allmählich Hochburgen der Kommunisten und Syndikalisten", schätzte Otto Hörsing (SPD) die politische Lage kurz nach dem Kapp-Putsch ein.
Bei den Reichstagswahlen am 6. Juni 1920 stimmen im Bezirk Halle-Merseburg für die USPD 45,2, SPD 8,8 (minus 16 Prozent) und KPD 1,6 Prozent der Wähler. Zusammen vereinen sie auf sich 55,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Weimarer Koalition von SPD, Zentrum und DDP verliert die absolute Mehrheit und zerbricht.
Der Wähler spricht der SPD 103 und der USPD 83 Abgeordnetensitze zu. Die Sozialdemokraten laden die USPD zur Teilnahme an ihrer Koalitionsregierung ein, weil sie daran glauben, damit ihre Position wesentlich verbessern zu können. Das Zentralkomitee der USPD antwortet darauf, dass die Partei nicht in eine Regierung eintreten könne, die sich an der Wiederaufrichtung des Kapitalismus beteiligt, weshalb sie schon aus der ersten Regierung nach dem Krieg ausgetreten war. "Für die USPD.", führt Eugen Prager (1921, 218) den Gedanken fort, "könnte also nur eine sozialistische Regierung in Betracht kommen, in der sie die Mehrheit habe, den bestimmenden Einfluss ausübe, und in der ihr Programm die Grundlage der Politik ist." Mit dieser Absage der USPD an eine Koalitionsregierung schliesst sich der politische Raum für gesellschaftlich alternative Entwicklungen.
Eine grosse Widersinnigkeit der Stadtgeschichte zurück
 |
|
Das
erste Denkmal für die Kapp-Putsch Kämpfer in Naumburg
auf dem Friedhof an der Weidenfelder Strasse. Es stammt wahrscheinlich
aus den 20er Jahren.
|
Die Gefahr der Errichtung einer Diktatur scheint gebannt. Wolfgang Kapp und Georg Wilhelm Schiele fliehen nach dem Scheitern des Putsches. Ihr Groll auf die Sozialisten und Kommunisten halt tausendfach durch die Republik. Eine irrationale Angst vor dem Kommunismus manifestiert sich.
Nach dem Zusammenbruch des Putsches fand die Rechtspresse, wie Werner Liebe (1956, 58) rekonstruierte, nicht ein Wort zur Verurteilung der Putschisten. "Statt dessen wies sie immer wieder auf die Gefahren der bolschewistischen Welle …. hin …"
Es vertieft sich die politische Kluft zwischen der sozialistisch / kommunistisch orientierten Arbeiterschaft und der deutschnationalen Bürgerschaft.
Gleich nach Wiederherstellung von Ordnung und Sicherheit in Naumburg beginnt die öffentliche Umdeutung des Widerstandes gegen den Kapp-Putsch als
spartakistisches Abenteuer.
Man will die Kämpfer des Aktionsausschusses in das Abseits der Geschichte drängen. Aber für die Anderen, die Bürger- beziehungsweise Einwohnerwehr, „die sich mit so außerordentlicher Aufopferung für die Aufrechterhaltung der Ordnung und den Schutz gegenüber dem Ansturm der Zerstörung einsetzten“, erbittet das Naumburger Tageblatt am 24. März 1920 „Liebesgaben“ und:
„Geldspenden nehmen die Sparkassen und Banken entgegen.“
Die Rote Chronik der Kreise Zeitz, Weißenfels, Naumburg (1931, 152) charakterisiert dies als grosse Widersinnigkeit der Stadtgeschichte und beklagt:
„Der Kapp-Putsch hatte noch lange Nachwirkungen, wenigstens für die Arbeiter. Trotzdem die alte Regierung Ebert wieder an das Ruder kam und eigentlich alle bestraft werden mußten, die den Putsch angezettelt oder unterstützt hatten, trat das Gegenteil ein. Bestraft wurden die, die geholfen hatten, den Putsch niederzuringen. Das ganze Jahr hindurch wurden Arbeiter verhaftet und später zu schweren Zuchthausstrafen verurteilt.“
Der Widerstand gegen Kapp als Kampf der roten Banden
Die Verdrehung von Tatsachen über den Widerstand gegen Kapp-Lüttwitz begünstigte politische Fehlurteile, brachte viel Unglück und Erniedrigung über die aktiven Gegner des Kapp-Putsches.
Mit der Umdeutung des Widerstands gegen Kapp-Lüttwitz in einen Kampf der roten Banden verunglimpft Helmut Böttcher die Tätigkeit der Aktionsausschüsse. Als Hauptschriftleiter der Halleschen Zeitung hat er darin eine gewisse Übung. Ein ums andere Mal bringt seine Zeitung in den Kapp-Tagen ihre Sympathie mit den Putschisten zum Ausdruck. Einen umfassenden politischen Angriff auf den Widerstand gegen den Kapp-Lüttwitz Putsch unternimmt er mit dem Buch
Kapp-Lüttwitz-Putsch. Generalstreik und Bürgerkrieg. Die Wahrheit über die Ereignisse in Halle (Saale) und Mitteldeutschland (1920).
Noch im Jahr des "militaristischen Staatsstreiches" (Volksstimme, Magdeburg) wartet er zumindest für Naumburg und Umgebung mit folgender kruden Darstellung (89f.) auf:
"Sowohl in Freyburg, wie in zahlreichen Orten des Naumburger Kreises, wurden Russen, zum Teil Offiziere, als Führer der spartakistischen Banden festgestellt. Auch wurde beobachtet, dass sich Zigeuner als Spitzel in den Diensten der roten Banden befanden.
Um die Stadt Naumburg wurde mehrere Tage erbittert gekämpft. Dabei gingen die roten Banden, wie überall, von dem Grundsatz aus, erst die weiter gelegenen Ortschaften auf dem Lande zu entwaffnen, und dann den Ring um die Stadt immer eng zu ziehen, bis der Angriff auf die Stadt selbst erfolgen konnte. Die Einwohnerwehr hielt die Stadt tapfer bis zum Eintreffen der Garnison, die vorher in Weimar verwendet worden war. Auf dem Marsche nach Naumburg hatte die Reichswehr ein starkes Gefecht bei Kösen, wo mehrere Unabhängige fielen."
Mit den Ereignissen hat dies wenig zu tun. Zum Beispiel sind in Naumburg und Umgebung als Führer keine Russen gesehen worden. Freilich im dreissig Kilometer entfernten Merseburg schon. Dort stellten sich einige Kompanien russischer Kriegsgefangener aus einem Lager auf die Seite der Arbeiterwehr (vgl. Schunke 62). Was ist aber mit den spartakistischen Banden gemeint? Etwa die Aktionsausschüsse? Sie zogen einen Ring um die Stadt, behauptet Helmut Böttcher. Um Naumburg jedenfalls nicht. Die Einwohnerwehr hielt die Stadt tapfer? Ja, sie schützte einige staatliche Gebäude. Und am 19. März stand sie gemeinsam mit der Reichswehr am Oberlandesgericht-Moritzwiesen und anderen Orten im Gefecht mit den Kapp-Gegnern. Dem Geist nach war sie tendenziell anti-republikanischer Art. Ausserdem barg die Verteilung von Waffen unter ausgewählten Bürger unabsehbare Folgen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Vom Standpunkt der inneren Sicherheit und Wahrung des Gewaltmonopols des Staates war die Aufstellung der Bürger- beziehungsweise Einwohnerwehren überhaupt nicht zu Ende gedacht, also politisch eine Fehlleistung.
Nicht nur Helmut Böttcher (1920), auch prominente Politiker missdeuteten oder entstellten den Kampf gegen die Militärrevolte. "…. wir haben auch der Sozialdemokratie vor Augen geführt," so Gustav Stresemann (1920, 202) von der Deutschen Volkspartei,
"dass es nicht um einen Kampf zwischen der alten Regierung und Kapp handele, sondern um einen Kampf gegen den Bolschewismus."
Es war natürlich viel einfacher, die Vogelscheuche des Bolschewismus durch die Stadt zu treiben, als sich den äußerst schwierigen geldpolitischen, dringenden wirtschaftlichen und wachsenden sozialen Problemen der Nachkriegszeit anzunehmen. "Nicht Kommunisten und Spartakisten bedrohen den Bestand der Demokratie und Gesellschaft," versucht 1920 Heinrich Ströbel das verbreitete politische Urteil über den Kapp-Putsch zu revidieren, "sondern Monarchisten und Militaristen."
Nationalsozialistische Geschichtspolitik
Den Gefallenen der Einwohnerwehr und des Landesjägerkorps weihen die Nationalsozialisten am 28. April 1935 in Naumburg ein Denkmal und ehren Kapp-Lüttwitz. Turnlehrer Friedrich Banse (Naumburg) schlägt bei dieser Gelegenheit wüst mit Worten um sich:
"Die rote Zwietracht aus dem Osten ging frei durchs deutsche Land, und die goldene Spinne aus dem Westen saugte blutgierig am deutschen Lebensmarke."
Die nationalsozialistische Geschichtspolitik entstellt die Ereignisse im Raum Naumburg-Weißenfels-Zeitz. Zum Teil greift sie dabei auf öffentliche Berichte, Mitteilungen und Verlautbarungen aus dem Jahr 1920 zurück.
Als der Putsch gescheitert, erschienen im Naumburger Tageblatt zwei Mitteilungen: Die Vorgänge in Naumburg seit der Gegenrevolution (24.3.1920) und Der kommunistische Putsch in Bad Kösen (25.3.1920). Hierzu ist eine Klarstellung angebracht:
- Nicht der
Bolschewismus war Anlass oder Ursache der Unruhen in Naumburg,
sondern die militante Rechte putschte unter Mitwirkung von Kreisrat Max
Jüttner, Georg Schiele (DNVP), der Naumburger Reichswehr (13./14. März)
und den Imponderabilisten.
- Genannte Berichte
verleugnen den mutigen Widerstand gegen den Putsch und machen die ungerechte
Behandlung der Anti-Kapp-Kämpfer durch die Polizei, das Militär
und die Naumburger Justiz nicht öffentlich.
- Beide Berichte
umgehen die Frage nach der Verantwortung des Oberbürgermeisters
von Naumburg und Militärkommandeurs für den blutigen Dienstag.
- Im Goldenen
Hahn (Naumburg) befand sich nicht wie das Naumburger Tageblatt
behauptet, die Zentrale der Spartakisten, sondern die
Arbeitsräume des gewählten Aktionsausschusses. Und es war
ein Treffpunkt der Kapp-Gegner. Nach dem blutigen Dienstag (16. März)
deponierten sie hier und im Fuchsbau (Schulstrasse) zeitweise Waffen.
Georg Schiele (Naumburg) delegimitiert die Republik
Von zehn bekannten Urhebern des Putsches entkamen sieben. Vor Gericht stehen lediglich Jagow, von Wangenheim und Georg Schiele (Naumburg). Unter Vorsitz von Senatspräsident Doktor von Pelargus beginnt am 7. Dezember 1921 vor dem Vereinigten II. und III. Strafsenat am Reichsgericht in Leipzig die Hauptverhandlung des Jagow-Prozesses. Er "war zuzeiten überhaupt nicht bei der Sache", registriert ein Beobachter. An den Wänden des Gerichtssaals gut sichtbar die Symbole der alten Zeit. Zwei riesige Ölgemälde vom deutschen Kaiser prangen hier. Es waren ja nur Äusserlichkeiten, sagte man denen, die daran Anstoss nahmen. "Äusserlichkeiten - aber solche, die Innerlichkeiten widerspiegeln."
"Dem Zeugen [Gottfried] Traub wurde ausdrücklich gestattet, einen längeren Stimmungsbericht zu verlesen, der den ungeheuren Jubel der Bevölkerung über das Kapp-Unternehmen schildere, und der mit den zu klärenden Fragen nicht das mindeste zu tun hatte." (Bauer)
Als Angeklagter vor dem Reichsgericht in Leipzig lehnt Georg Schiele jede Verantwortung ab. Er betrachtet (A) "das Kapp-Unternehmen [als] nicht verfassungswidrig". (B) Angeblich sollte nur der geltenden Verfassung zum Recht verholfen werden. Er war (C) nicht Urheber und (D) Führer des Unternehmens. - Nur einmal besuchte er die Nationale Vereinigung, "bin bloss Zuschauer gewesen", schränkt der völkisch-deutschnationale Politiker vor Gericht seine Verantwortung ein. (Vgl. Brammer 1922, 10, 70-71).
"Die außerordentliche große geschichtliche und rechtliche Bedeutung des Leipziger Hochverratsprozesses", betont Karl Brammer (1922, 7), steht "außer allem Zweifel", weil er den Angriff auf das in der Revolution gewordene Recht abwehrt. Georg Schiele (Naumburg) unternahm den Versuch es zu delegitimieren, um den Hochverratsparagraphen zu erschüttern. Zu seiner Verteidigung brachte er die alles entscheidende Frage auf,
ob ".... jedes Recht und jede Rechtsordnung in Deutschland [am 9. November 1918] aufgehört hat".
"Das Reichsgericht in Leipzig hat diese Frage verneint und hat sich damit die allgemein anerkannte Auffassung der Staatsrechtslehrer zu eigen gemacht, die da sagen, daß die Anerkennung einer durch Umsturz entstandene Verfassung eine Machtfrage. Die Revolution ist ein Grenzfall, in dem sich das Recht der Macht zu beugen hat." (Brammer 1922, 10)
Natürlich wirft dies interessante rechtsphilosophische Fragestellungen auf. Vom Standpunkt des positiven Rechts, ergibt eine zweifache Bedeutung der Revolution: "Die Revolution, die misslingt ist Hochverrat, strafbares Unrecht. Die Revolution, die gelingt ist eine Rechtsquelle, die neues Recht schafft." (Beling 1923)
Das Reichsgericht muss Schieles Rechtsauffassung, nicht zuletzt in Anbetracht der Tatsache, dass das Volk als Souverän für das Recht auftritt, zurückweisen. Andernfalls stellt es die aus der Französischen Revolution von 1789 hervorgegangene Rechtsordnung - also die bürgerliche Gesellschaft - als Ganzes in Frage.
Das Verfahren gegen den Angeklagten von Wangenheim und Doktor Georg Schiele wurde nach Paragraph 1 Absatz 2 und Absatz 1 des (Amnestie-) Gesetzes vom 4. August 1920 eingestellt. Ihm ist es in Leipzig nicht gelungen, den Hochverratsparagraphen durch seine rechtspolitische Argumentation zu erschüttern. Mithin tut er fortan alles, um die Weimarer Republik und Demokratie zu delegitimieren. Grundlage bildet seine Überzeugung von der Nichtexistenz der Rechtsordnung.
KPD-Zentrale verpasst den Auftakt
"Die Kommunisten hatten sich von Anfang mit an die Spitze des Kampfes gegen Militärdiktatur gestellt", instruiert die Schrift März 1920, Arbeiterklasse vereitelt den Kapp-Putsch (1981, 158) den Leser. Bei allem, was recht ist, es scheint etwas anders gewesen zu sein. Zunächst nimmt die KPD-Zentrale zum Kapp-Lüttwitz-Putsch eine abwartende Haltung ein. "Das Proletariat", verkündet sie im Aufruf vom 13. März 1920,
"wird keinen Finger rühren
für die demokratische Republik."
"Die Arbeiterklasse wird den Kampf gegen die Militärdiktatur aufnehmen in dem Augenblick und mit den Mitteln, die ihr günstig erscheinen. Dieser Augenblick ist noch nicht da."
Die Verspätung der KPD-Zentrale erklären Erwin Könnemann und Hans-Joachim Krusch (1981, 90) durch den Einfluss des Organisationsleiters der KPD Reuter-Friesland, dessen erster Bericht am 13. März zur Lage in Berlin die Kampfbereitschaft der Massen unterschätzte und die Aufgabe der Niederschlagung des Putsches verkannte.
Erst am 15. März ruft die KPD-Zentrale zum Generalstreik auf. Für die Region Halle-Weißenfels-Zeitz-Naumburg ist dies von untergeordnetem praktischen Interesse. Denn bereits am 13. März proklamieren die Bezirksleitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die Bezirksleitung der Unabhängigen Sozialdemokraten und die Bezirksleitung der Kommunistischen Partei für den Regierungsbezirk Merseburg den Generalstreik. Sofort aktivieren sich, wie in Naumburg oder in Bad Kösen zu beobachten, KPD-Mitglieder und nehmen aktiv am Widerstand gegen Kapp-Lüttwitz teil. Von einer politisch-ideologischen Okkupation der Anti-Kapp-Bewegung durch die Kommunistische Partei kann keine Rede sein.
Kritik der USPD an der KPD
Robert Dissmann (1878-1926), der 1914 gegen die Bewilligung der Kriegskredite und Burgfriedenspolitik opponierte, bringt am 12. Oktober 1920 auf dem USPD-Parteitag Halle folgende Kritik zur Rolle der KPD-Führung während der Märztage vor: "Das war Kamerad [Wilhelm] Koenen [1920 Mitglied der KPD] … Jener revolutionäre Kamerad hatte in jenen Tagen nicht mehr Kourage wie Karl Legien und Genossen. (Sehr richtig. Beifall und Widerspruch.) Jawohl, so steht die Sache. Und ich habe die Leute und die Parteigenossen kennengelernt in jenen Tagen [des Kapp-Putsches]; sie waren herzlich froh, an den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, an die Afa sich stützen zu können, sich an ihre Rockschösse hängen zu können. (Sehr richtig!) SO war`s bei Euch und keinen Deut anders. (Beifall.) Als aber dann, werte Parteigenossen, der Karfreitag kam, da stellten sich dieselben tapferen Kämpfer die mit uns im Kämmerlein gemeinsam getagt und beschlossen hatten, da stellten sie sich auf die Straße und sagten: seht jene Arbeiterverräter! (Hört, hört!) Genossen, wenn man eine solche treulose Kameradschaftlichkeit bei Lichte betrachtet, so kann ich nur sagen, für solche Methoden hat ein ehrlich denkender Mann nur Verachtung übrig. (Lebhafter Beifall.)" (Protokoll 39)
Waffenstillstand oder Fortsetzung des Kampfes?
1960 bedauert die Schrift
März 1920
Der Beitrag der Arbeiterklasse der Kreise
Weißenfels, Naumburg, Hohenmölsen und Zeitz (26),
dass der militärische Kampf durch die Arbeiter nicht bis zum Umsturz fortgesetzt wurde. Die Autoren beherrscht die Vorstellung: Je mehr militärischer Widerstand, desto besser. Sie war, wie der Fall Albert Bergholz (Zeitz) zeigt, zur Obsession geworden. Vierzig Jahre nach den erfolgreichen Verhandlungen, die er mit der Reichswehr in Zeitz über einen Waffenstillstand führte, wirft ihn die in Weißenfels erschienene Schrift vor, "die Erfolge der Arbeiterklasse restlos preisgegeben und den Klassenstandpunkt verraten" zu haben, obwohl "die Lage der Kappisten völlig hoffnungslos war" und "die Arbeiter eindeutig alle Trümpfe in der Hand hielten". Das war mithin das Schlimmste, was man über einen Mitkämpfer und Genossen sagen konnte. Ist beziehungsweise war es denn aber berechtigt?
Ein erster, zugegeben ziemlich simpler Einwand, ergibt sich aus dem Umstand, dass diese Einschätzung auf der taktischen Bewertung des militärischen Kräfteverhältnisses zwischen den Anti-Kapp-Kämpfern und Reichswehr gründet. Aus strategischer Sicht fällt sie wahrscheinlich anders aus.
Über die Durchführung von Verhandlungen mit der Reichswehr bestanden zwischen den KPD- und USPD-Genossen offenbar Unstimmigkeiten. Sie sind erheblich schwieriger zu rekonstruieren. Überliefert ist, dass die "Vorschläge und Bedingungen" der Verhandlungen "ohne Kenntnis der Kommunisten von den Unabhängigen unter sich ausgemacht und von Bergholz formuliert worden" sind. Während "die Kommunisten die Verantwortung für alle Massnahmen des Aktionsausschusses inne hatten, führten die rechten USPD-Führer [mit Bergholz] Seperatverhandlungen." Das war ärgerlich resümiert 1960 der Forschungsbericht Zeitzer Arbeiter schlagen den Kapp-Putsch nieder (213), veröffentlicht vom Autorenkollektiv der Abteilung Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung vom Franz-Mehring-Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig. Was dann im Weiteren als Separatverhandlung bezeichnet wird, könnte vielleicht das Resultat einer Entscheidung sein, die die USPD im Zeitzer Aktionsausschuss (SPD, KPD, Gewerkschaften), wo sie die Mehrheit besitzt, herbeigeführt hat. Andererseits ist denkbar, dass die verantwortlichen Akteure eine kollektive Beratung vermieden, weil sonst heftige Konflikte aufzubrechen drohten. Denn die Bildung der Arbeiterwehr und Requirierung der Waffen in den umliegenden Dörfern lag in den Händen des Kommunisten Walter Gaudes (Zeitz).
Die KPD handelte gemäss dem ideologischen Theorem der Interdependenz von innenpolitischer und militärischer Macht. Ihre Zentrale formuliert es in der Erklärung vom 21. März 1920 wie folgt:
Wo "dem Proletariat noch keine ausreichende militärische Macht zur Verfügung steht", sind "die objektiven Grundlagen für die proletarische Diktatur im gegenwärtigen Moment nicht gegeben".
Daraus folgt, je grösser die militärische Macht (Kraft) der KPD, desto günstiger für den innenpolitischen Progress. Ähnlich propagierte es am 20. November 1918 Rosa Luxemburg in der Roten Fahne:
"Der Bürgerkrieg den man aus der Revolution mit ängstlicher Sorge zu verbannen sucht, lässt sich nicht verbannen. Denn Bürgerkrieg ist nur ein anderer Name für Klassenkampf …."
Wie war aber die Lage?
(A)
Über die Frage des Aufstandes kommt es im Oktober 1920 auf dem USPD-Parteitag in Halle
erneut zu einer heftigen Debatte. Kurt Rosenfeld (1877-1943), der öfters
vor den Naumburger Gerichten als Verteidiger für die Linken auftritt,
stellt die Frage:
"Ist es möglich einen Generalstreik zum bewaffneten Aufstand auszugestalten?"
"Und da will ich erklären, dass für solche Fragen unser Fachmann in der Zentralleitung [der USPD] der Genosse [Ernst] Däumig [seit Dezember 1919 Vorsitzender der USPD] gewesen ist, und dass Däumig bei jeder Gelegenheit von uns befragt worden war: ist es möglich einen bewaffneten Aufstand zu machen? und dass er jedes Mal erklärt hat, das ist unmöglich. (Hört, hört! Zuruf: von Berlin!)" (Protokoll 52)
(B) Zu den Lehren aus der Märzaktion (1921, 8) gehört, dass "bei keiner dieser Kämpfe" "auch nur die Spur der ideologischen und organisatorischen Bereitschaft für den Bürgerkrieg zu finden" war. Wohl bezieht sich dies wie ersichtlich wesentlich auf den Leuna-Aufstand, doch darf man diese Lage-Beurteilung durchaus auch für den März 1920 heranziehen.
(C) Überdies wäre der Ausgang eines Bürgerkrieges keineswegs gewiss. Erinnert sei nur an die Schwarze Reichswehr, Bürgerwehr und Freikorps. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner (Naumburg) nennt es 1920 in einer Rede vor der Nationalversammlung die "leise Schiebung nach rechts".
(D) Ein Bürgerkrieg kann den Hunger nicht besiegen. Deutschland benötigt alle sozialen Energien für die Schulreform, demokratische Erneuerung der Justiz, Armee, Polizei und zur Überwindung der Wohnungsnot. Ein Bürgerkrieg wäre in dieser Situation die höchste, zugleich elendigste Form des Kampfes um die politische Macht, die Kapitulation vor der Vernunft. Das war nicht der allgemeine politische Wille der Kapp-Gegner in Naumburg, Zeitz, Weißenfels und Bad Kösen.
Damit sind genügend Gründe aufgezeigt, warum das politische Urteil von 1960 über den Verhandlungsführer der Arbeiter in Zeitz revidiert werden muss. Es lautet:
Albert Bergholz handelte am 17. März 1920 in Zeitz angemessen und politisch verantwortungsvoll.
Fortsetzung des Kampfes?
|
Natürlich bestand der historische Fehler der Kapp-Gegner nicht in der vorzeitigen Beendigung des militärischen Kampfes. Vielmehr weist das Konzept des Widerstandes Mängel auf. Mit dem Generalstreik waren kaum weitergehende Forderungen zur Demokratisierung der Stadt und Gesellschaft - wie etwa die Besetzung der Schlüsselpositionen in Justiz, Polizei und Reichswehr mit Demokraten - in ernsthafte Verhandlungen getragen worden. Die rechtskonservative Machtelite wusste um diese Schwäche ihrer Gegner. So erklärte der Erste Staatsanwalt von Naumburg,
"dass sei eben das Gute, dass die Revolution das deutsche Justizwesen in keiner Weise umgestaltet und seinen Vertretern die volle Macht und Befugnisse aus der Zeit bis November 1918 belassen hatte." (Justiz)
Immerhin entstand das am 20. März beschossene 9-Punkte-Programm und überschreiten damit allmählich die Ressourcen dieser Arbeit.
Ausschaltung des Bürgertums?
Am 12. Juni 1920 erscheint in russischer Sprache die Schrift Der "Linke Radikalismus" die Kinderkrankheit im Kommunismus. Autor Wladimir Iljitsch Lenin analysiert darin die zurückliegenden März-Ereignisse in Deutschland und stützt sich dabei auf die am 26. März in der Roten Fahne erschienenen Erklärung der Zentrale der KPD vom 21. März 1920. Er bezeichnet sie sowohl der "Hauptvoraussetzung" als auch der "praktischen Schlußfolgerung nach [für] vollkommen richtig". Die KPD behauptet darin:
"Der proletarische Kampf gegen die Militärdiktatur war ein Kampf gegen die bürgerlich-sozialistische Koalition und hat zum Zwecke, die politische Macht der Arbeiterschaft zu erweitern bis zur vollständigen Ausschaltung des Bürgertums."
Das wirft Fragen auf.
Erstens. Warum eigentlich sollen die Kapp-Gegner das Bürgertum ausschalten? Ihr Ziel war doch gemeinsam mit dem republikanischen Bürgertum, was in Naumburg nicht gerade stark ausgebildet war, den Putsch abzuwehren.
Abgesehen davon, war dies eine falsche politische Losung und Herangehensweise. Mit dem politischen Prinzip "ausschalten" kann keine sozialistische Politik gedeihen.
Zweitens. Die Kapp-Gegner in Naumburg, Bad Kösen, Weißenfels und Zeitz kämpften nicht "gegen die bürgerlich-sozialistische Koalition". Ihr Ziel war nicht der Umsturz oder die Errichtung einer Räterepublik. Albert Bergholz (1892-1957) betont auf der USPD-Versammlung am 5. Mai 1920 in Naumburg, dass die Arbeiter die Waffe nur in die Hand genommen hätten,
"um die Gegenrevolution zu stürzen und verfassungsmässige Regierung wieder aufzurichten."
Das Naumburger Tageblatt vom 24. März 1920 bestätigt dies - vielleicht eher ungewollt - in der Meldung: "Nach einem ziemlich bewegten Sonntag [14. März 1920] trat am Wochenbeginn der Ausstand der Arbeiterschaft, der sich gegen die neue [!] Regierung richtete, in Erscheinung."
Mit Wort und Tat kämpft der Naumburger Aktionsausschuss, wie er klar und eindeutig in der Erklärung vom 18. März 1920 kundtut, gegen die reaktionären Gewaltpolitiker in Deutschland und für die Weimarer Republik. Der Widerstand gegen den Putsch in Naumburg war weder ein verkappter bolschewistischer Bubenstreich noch verstand er sich als Teil einer Revolte gegen die Regierung Ebert-Bauer.
Revolutionäre Kampfgruppen
|
Etwas anders sind die Aktionen der revolutionären Kampftruppen vom 19. bis 22. März in der Schlacht um Halle zu bewerten. "Niemand, der sich selbst als revolutionäre Kampfgruppe bezeichnet hat", argumentiert Zivilkommissar Walther Schreiber (34), "kann leugnen, dass die Bewegung dieser Kampfgruppe sich gegen die Verfassung und das Gesetz richtet, sonst hätte schon der Name revolutionäre Kampfgruppe gar keinen Sinn gehabt. Die Massen der Arbeiterschaft sind also durch verantwortungslose Führer getäuscht und in die Irre geführt worden. Die Führer der Bewegung wussten mindestens von Freitag, dem 19. März ab, dass es in Halle eine Gegenrevolution nicht mehr zu bekämpfen galt."
Revolution Ja und Nein
Lenin nimmt in der "Linke Radikalismus", die Kinderkrankheit im Kommunismus die revolutionstheoretische Debatte zur "Eroberung der proletarischen Massen für den Kommunismus" wieder auf. Im Absatz, eingeleitet mit Die wahre Natur der jetzigen Führer der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, attackiert Lenin die USPD-Führer Artur Crispien und Karl Kautsky, nennt sie "weinerliche spießbürgerliche Demokraten". "Diese Herrschaften sind völlig außerstande," urteilt er, "wie Revolutionäre zu denken und zu urteilen."
Zuvor stimmte er ausdrücklich der KPD-Erklärung vom 21. März zu, die ausdrücklich darauf hinweist, dass die "proletarische Diktatur" "nicht aufgerichtet werden" kann, weil das "revolutionäre Bewusstsein" fehlt und das "Proletariat noch keine ausreichende militärische Macht zur Verfügung" hat. - Was denn nun? Revolution Nein, weil die objektiven Bedingungen nicht gegeben sind! Revolution Ja, wenn es die Polemik erfordert? Lenins Ausfälle gegenüber der USPD kommen zur Unzeit, kämpften doch ihre Mitglieder in Zeitz, Weißenfels, Naumburg, Bad Kösen und vielen anderen Orten selbstlos, kreativ und engagiert gegen Kapp-Lüttwitz. Dafür nahmen sie schwere und existenzbedrohende Konflikte auf sich.
Als die USPD-Mitglieder im Herbst 1920 zur Urwahl über den Anschluss an die III. Internationale unter den 21 Bedingungen schreiten, sind die Attacken aus dem Kreml nicht vergessen. Als einziger Unterbezirk im roten Mitteldeutschland kontert Naumburg-Zeitz-Weißenfels die 3 408 Dafürstimmen mit 4 663 Gegenstimmen.
|
Lenins Argumentation läuft ausserdem ins Leere, weil im März 1920 in Deutschland keine revolutionäre Situation bestand. Die von der KPD am 13. März popularisierte Utopie Für die Diktatur des Proletariats! Für die deutsche kommunistische Räterepublik! resultiert nicht aus einer Analyse. Es ist ein ideologisches Konstrukt, dass an kommunistische Nachkriegsstimmungen und die Enttäuschung über die Sozialdemokratie anknüpft, aber unter revolutionstheoretischem Gesichtspunkt keine Anhaltspunkte oder Argumente enthält.
Vergessen oder erinnern?
Vergessen - das können sie nicht. Deshalb rufen KPD und RFB in Naumburg am 25. März 1928 zu einer Kranzniederlegung an den Gräbern der Märzgefallenen auf dem Friedhof Weißenfelser Straße auf. Anschliessend ziehen die 700 durch die Stadt mit Transparenten, wovon eine Losung lautet:
1920: Kapp-Putsch, Arbeitermord. 1928: Arbeiter stürzt die bürgerliche Regierung.
Auf dem Marktplatz stehen sie zur Kundgebung zusammen. Johannes Schröter (1896-1963) aus Halle hält die Ansprache. Der KPD-Funktionär poltert über die Passfälschungen, angeblich im Juni 1922 durch die Stadtverwaltung zugunsten der Rathenau-Mörder Kern und Fischer begangen. Bereits am 8. Februar 1928 griff der Klassenkampf, das Organ der Kommunistischen Partei für den Bezirk Halle-Merseburg, dieses Problem auf. Heute bezeichnet der Redner den Oberbürgermeister Arthur Dietrich als einen Verantwortlichen für diesen Skandal.
"Dieser Schuft!",
ruft daraufhin Kundgebungsteilnehmer Adolf Schuster aus Altenburg (Almrich) in die Menge. Gemeint ist der Oberbürgermeister, vermerkt Kriminalsekretär Mollenhauer in einem handschriftlichen Bericht vom 28. März 1928 an seinen Vorgesetzten. Am 27. März 1933 ordnet Bürgermeister Karl Roloff die Schutzhaft von Adolf Schuster an.
|
Mahnmal für die Kämpfer gegen den Kapp-Putsch auf dem Friedhof Weißenfelser Straße (2010) |
Zum Gedenken an den Widerstand gegen den Kapp-Putsch wird am 20. März 1958 auf dem Neuen Friedhof von Naumburg ein Ehrenhain eingeweiht. Das Monument trägt die Inschrift: Ruhm und Ehre den Helden der Arbeiterklasse. Seine Einweihung geht wahrscheinlich auf einen Beschluss der SED-Kreisleitung Naumburg zur Schaffung eines Ehrenhains aus dem Jahr 1956 zurück. V orher stand hier bereits ein Gedenkstein. (Siehe Bild im Absatz: Die Gefahr der Errichtung einer Diktatur ....)
Die Alternative Jugend Sachsen-Anhalt Süd kultivierte das Areal und sanierte das Denkmal Anfang 2010. Bei einem Treffen am 19. März 2010 ehrten sie den Widerstand der Arbeiter gegen Kapp-Lüttwitz in Naumburg und Bad Kösen.
Aktennotiz. Staatsanwaltschaft am Landgericht. Naumburg, den 18. August 1920. Staatsanwaltschaft beim Landgericht Naumburg im Jahre 1920. General-Akten. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg, Rep. C 141 Staatsanwaltschaft, Naumburg 25-1, Blatt 222 bis 225
[Albert] Bericht des
Unterstaatssekretärs Albert über die Vorgänge in der Reichskanzlei
am 13. März 1920 morgens. Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik
- Das Kabinett Bauer. Band 1. Dokumente. Nr. 189. Bericht des Unterstaatssekretärs
Albert über die Vorgänge in der Reichskanzlei am 13. März
1920 morgens, Seite 677 bis 679.
http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/10a/bau/bau1p/kap1_2/para2_191.html;jsessionid=
556E6039C77A3DB4F5EB29FB5AEBC264?highlight=
true&search=Jagow&stemming=false&pnd=&start=&end=&field=all
An die Reichsregierung
von Sachsen-Weimar-Eisenach. Erklärung [gegen die verräterische
Haltung von General Hagenberg, stellvertretender Kommandeur der Reichswehrbrigade16].
"Jenaer Volksblatt", Jena, den 16. März 1920
Amann, Fritz: Biographie. Nach: http://www.mv-naumburg.de/index.php/fritz-amann
Amtliche Bekanntmachung [zur Ankunft bayerischer Truppen am 29. März 1920 in Naumburg]. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 30. März 1930
An die arbeitende Bevölkerung Deutschlands! Freiheit. Organ der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Berlin, den 16. März 1920
Aufforderung der Reichszentrale für Einwohnerwehren an die Einwohnerwehren zur Unterstützung des Staatsstreichs. Berlin, den 13. März 1920. In: Erwin Könnemann, Gerhard Schulze (Herausgeber): Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch, Olzog Verlag, München 2002, Seite 160
Aufforderung des Garnisonsältesten von Halle [Halle, 19. März 1920]. In: Erwin Könnemann, Gerhard Schulze (Herausgeber): Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch, Olzog Verlag, München 2002, Seite 692 bis 693
Ein Aufruf der Reichsregierung. "Deutsche Allgemeine Zeitung", Berlin, den 2.März 1919
Aufruf des ADGB und der AFA zum Generalstreik. Berlin, den 13. März 1920. In: Erwin Könnemann, Gerhard Schulze (Herausgeber): Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch. Olzog Verlag GmbH, München 2002, Seite 155 bis 156
Aufruf des Aktionsausschusses für Mitteldeutschland und der Streikleitung Halle zum Kampf gegen die Hochverräter [Halle, 14. März 1920] (veröffentlich im Volksblatt, Halle vom 15. März 1920). In: Arbeiterklasse siegt über Kapp Lüttwitz. Quellen ausgewählt und bearbeitet von Erwin Könnemann, Brigitte Berthold und Gerhard Schulze, Akademie Verlag, Berlin 1971, Seite 378 bis 379
[Aufruf der KPD zum Kampf gegen den Kapp-Putsch] Militärdiktatur oder Proletarierdiktatur? Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands, 13. März 1920
Aufruf des Oberpräsidenten [Hörsing]. An die Bevölkerung der Provinz Sachsen! Magdeburg, den 14. März 1920 In: "Magdeburger Mitteilungen", Magdeburg, den 16. März 1920
"Aufruf zum Generalstreik" von Ebert, Noske, Schmidt, Schlicke, David. "Volksstimme", Magdeburg, den 14. März 1920, Seite 1
[Ausnahmezustand] Die verschärfenden Bestimmungen des Ausnahmezustandes aufgehoben. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 29. März 1920
[Banse] Auszug der Rede von Turnlehrer Friedrich Banse. In: "Und über Deutschland steht das Morgenrot!". Denkmalsweihe für die Gefallenen der ehemaligen Einwohnerwehr und des Landesjägerkorps. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 29. April 1935
Barbara (e.V.). Offizierskameradschaft des ehemaligen 2. Thür. Feldar.- Rgts.., Nachrichtenblatt, Nr. 55, Naumburg (Saale) 1939
[Bauer] Rede des Reichskanzler Bauer in am 18 März 1920 in Stuttgart. In: Karl Brammer: Fünf Tage Militärdiktatur: Dokumente der Gegenrevolution. Verlag für Politik und Wirtschaft, Berlin 1920, 72 ff.
Bekanntmachung. Weimar, den 13. März 1920. Hagenberg, Generalmajor und Stellvertretender Kommandeur der Reichswehr-Brigade XVI.
Bekanntmachung. Weimar, den 14. März 1920. Hagenberg, Generalmajor und Stellvertretender Kommandeur der Reichswehrbrigade XVI.
Bekanntmachung. Naumburg, den 23. März 1920. Militärbefehlshaber von Feldmann, Oberst und stellvertretender Führer der Reichswehrbrigade XVI.. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Naumburg, Nummer 25 -1
Bekanntmachung. Naumburg, den 23. März 1920. Militärbefehlshaber von Feldmann, Oberst und stellvertretender Führer der Reichswehrbrigade XVI.. Querfurter Tageblatt, Querfurt, den 23 März 1920
Beling, Ernst: Revolution und Recht. Sozialphilosophische Vorträge und Abhandlungen. Herausgegeben von Ernst Beling, Moritz Geiger und Adolf Weber. Heft 3, Dr. Benno Filser Verlag, Augsburg 1923. Zitiert nach Ph. Heck. Das Urteil des Reichsgerichts vom 28. November 1923 über die Aufwertung von Hypotheken und die Grenzen der Richtermacht. In: Archiv für die civilistische Praxis N.F. Band 122, 1924), Seite 203-226
Bergmann, Ernst: Aus dem Bericht des Leuna-Arbeiters Ernst Bergman. In: Joachim Schunke: Die Schlacht um Halle. Gewehre in Arbeiterhand. Die Abwehr des Kapp-Putsches in Halle und Umgebung. Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung, Berlin 1956, Seite 110 bis 111
Bettenhäuser, Matthias: Gegen den Kapp-Putsch in Weimar. März 2000. Website: Das soziale Weimar. SPD. (2006: http://archive.is/F8Ut)
Bericht über die Versammlung vom 21. Juli 1920 in Naumburg (Saale) mit Bernhard Düwell als Referenten. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. C 141 Naumburg, Nr. 25-1, Blatt 218 bis 221
Bekanntmachung. Der Militärbefehlshaber v. Feldmann, Oberst und stellvertretender Führer der Reichswehrbrigade XVI. Naumburg, den 23. März 1920. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. C 141 Naumburg, Nr. 25-1
Beuthan, Kurt: Der Kapp-Putsch in Weißenfels. In: Joachim Schunke: Die Schlacht um Halle. Gewehre in Arbeiterhand. Die Abwehr des Kapp-Putsches in Halle und Umgebung. Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung, Berlin 1956, Seite 107 bis 110
Böttcher, Helmut (Hauptschriftleiter der "Halleschen Zeitung"): Kapp-Lüttwitz-Putsch. Generalstreik und Bürgerkrieg. Die Wahrheit über die Ereignisse in Halle (Saale) und Mitteldeutschland. Dargestellt auf Grund amtlicher Dokumente. Historisch-politischer Verlag, Leipzig 1920
Brammer, Karl: Fünf Tage Militärdiktatur. Dokumente der Gegenrevolution. Verlag für Politik und Wirtschaft, Berlin 1920
Brammer, Karl: Verfassungsgrundlagen und Hochverrat. Beiträge zur Geschichte des neuen Deutschlands. Nach stenographischen Verhandlungsberichten und amtlichen Urkunden des Jagow-Prozesse. Verlag für Politik und Wirtschaft, Berlin 1922
Brauer, Max, Obersekundaner aus Schulpforte. Zeugenaussage vor dem Staatsanwalt in den Ermittlungen gegen Walter Fieker am 30. März 1920 im Gefängnis von Naumburg. Vorverfahren in der Strafsache wider Fieker. Blattsammlung der Staatsanwaltschaft beim Landgerichte in Naumburg an der Saale. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft, Hilfsakten. Naumburg
Bregler, Klaus (Heidelberg): Bericht über ein (zu) früh geendetes Leben. Manuskript. Heidelberg, 2015. (Ein Bericht über das Leben von Karl Reimhold, geboren am 23. August 1901, gefallen bei den Kämpfen am 23. März 1920 im Raum Markröhlitz, Pödelist und Luftschiff.)
[Brief 16.6.1920] Brief vom Deutschen Bergarbeiterverband (Max Köhler), Gewerkschaftskartell (Günther), Deutschen Metallarbeiterverband (Kittelmann), Maschinen- und Heizer Verband (Drygalla), Vorsitzenden USPD-Ortsvereins und Vertrauensmann Deutscher Landarbeiter (Waitz) aus Mücheln an Oberpräsidenten Otto Hörsing - 16. Juni 1920. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt. Merseburg, C 141 Naumburg 25-1, Blatt 206 und 207
Brygalski, Erster Staatsanwalt. Betrifft Unruhen in Naumburg a.S.. An den Herrn Justizmister in Berlin durch den Herrn Oberstaatsanwalt in Naumburg a.S.. Naumburg, den 14. April 1920. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt. Merseburg, C 141 Naumburg 25-2, Blatt 23 ff.
[Budde, Thomas:] Bad Kösen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Kaiserreich - Weimarer Republik - Drittes Reich. Webunterseite: Solbad und Stadt Kösen 1868-1945. http://www.badkoesen-geschichte.de/index.php/solbad-und-stadt-koesen-1868-1945.html [Autor auf dieser Seite nicht angegeben. Wahrscheinlich aber: Thomas Budde, Bad Kösen.]
(Chronik) Unter der Herrschaft Kapp-Lüttwitz. In: Erste Beilage zur Vossischen Zeitung. Berlin, den 24. März 1920
Das Leunawerk. Lehren aus der Märzaktion. Frankes Verlag, GmbH Leipzig, Berlin 1921
Das Programm der USPD. "Volksbote. Sozialdemokratisches Organ für die Kreise Zeitz, Weissenfels, Naumburg", Zeitz, den 13. März 1919
Das Treffen in Bad Kösen. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 24. März 1920
Das Waffenlager im Zeitzer Forst. Der Kommunist Ullman brauchte Geld. "Leipziger Volkszeitung. Organ für die Interessen des gesamten werktätigen Volkes", Leipzig, den 13. April 1928
[DDP] Chronik der Kämpfe. Merseburger Korrespondent, 28. Und 30. März 1920. Auszüge aus dem "Merseburger Korrespondent" (DDP) über die Kämpfe in Merseburg und Umgebung. Merseburg, den 27. März 1929. In: Erwin Könnemann, Gerhard Schulze (Herausgeber): Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch, Olzog Verlag, München 2002, Seite 705 bis 711
[Denkmalsweihe] "Und über Deutschland steht das Morgenrot!". Denkmalsweihe für die Gefallenen der ehemaligen Einwohnerwehr und des Landesjägerkorps. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 29. April 1935
[Denkschrift] Anonyme Denkschrift über die Notwendigkeit eines Umsturzes. O.O. 12. August 1919. In: Erwin Könnemann, Gerhard Schulze (Herausgeber): Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch, Olzog Verlag, München 2002, Seite 21 bis 23
Der Kampf geht weiter. Die Rote Fahne. Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund). Berlin, den 27. März 1920
Die Streikbewegung im Reiche. "Volksstimme". Sozialdemokratisches Organ für den Regierungsbezirk Magdeburg. Magdeburg, den 5. März 1919
[Deutsche Zeitung. In:] Das Altenburgische Staatsministerium an den Reichspräsidenten. Altenburg, den 28. April 1920. In: Akten der Reichskanzlei. Weimarer Kabinett - Das Kabinett Müller. Band I, Dokumente, Nummer 71, Seite 172 bis 174. http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/0a1/mu1/mu11p/kap1_2/para2_71.html
Deutschnationaler Putsch?. "Volksstimme", Magdeburg, den 13. März 1920
Dittmar, Kurt: [Aussage zum Marsch nach Bad Kösen am 19. März 1920 mit Gruppe Fieker]. In: März 1920. Der Beitrag der Arbeiterklasse der Kreise Weißenfels, Naumburg, Hohenmölsen und Zeitz bei der Niederschlagung des militaristischen Kapp-Putsches. Herausgegeben von Kreisleitung der SED Weißenfels, Weißenfels 1960, Seite 33
[Dietrich] Bericht des Oberbürgermeisters der Stadt Naumburg a. S. an den Herrn Zivilkommissar des Regierungsbezirks Merseburg vom 9. April 1920
Dietrich, Arthur. Tgb.-Nr. P 15/20 V. - 19.4.1920. Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Staatsanwaltschaft in Naumburg, General-Akten, Rep. C 141, Nr. 25-1, Blatt 91 bis 96
[Dietrich, Arthur] Strafantrag. An den Herrn Staatsanwalt in Halle. 12. Mai 1920. Stadtarchiv Naumburg (Saale). Sonderakten des Magistrats Naumburg an der Saale. Angefangen 1. Januar 1920. Geschlossen 1922. Signatur 9381, Blatt 71
Dietrich, Oberbürgermeister. Brief vom 27. Mai 1920 an den Staatsanwalt in Naumburg. Strafsache gegen den Schriftleiter Karl Garbe. Stadtarchiv Naumburg. Sonderakten des Magistrats. Band V: Angefangen 1. Januar 1929, Geschlossen 1922. Blatt 75
Dietrich, Werner: Schiele als Wirtschaftsminister. Kapp-Putsch. Naumburger Bürger maßgeblich in Vorbereitung und Durchführung des Staatsstreichs verstrickt. "Burgenland-Journal, Naumburger Tageblatt", Ostern 2010, Seite 3
Dreetz, Dieter, Klaus Gessner, Heinz Sperling: Bewaffnete Kämpfe in Deutschland 1918-1923. Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1988
[DVP] Erklärung der Deutschen Volkspartei vom 13. März 1920. In: Gustav Stresemann: Die Märzereignisse und die Deutsche Volkspartei. Staatspolitischer Verlag G.m.b.H., Berlin, 1920, Seite 27
[DVP] Aufruf der Fraktion
des Deutschen Reichstages der Deutschen Volkspartei am 18. März 1920.
In: Gustav Stresemann: Die Märzereignisse und die Deutsche Volkspartei.
Staatspolitischer Verlag G.m.b.H., Berlin, 1920, Seite 27f.
Düwell, Bernhard, Abgeordneter: Rede. Verhandlungen des Deutschen Reichstages, Reichstagsprotokolle 1920, 13. Sitzung. Donnerstag, den 29. Juli 1920 (http://www.reichstagsprotokolle.de)
Erklärung der Vertreter des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände und des Deutschen Beamtenbundes über das Ende des Generalstreiks am 20. März 1920. In: Das Ende des Streiks. "Vossische Zeitung", Berlin, den 24. März 1920
Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger und Siegfried Schumann: Wahlen und Abstimmung in der Weimarer Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919-1933. Verlag C.H. Beck, München 1986
[Feldmann, von, Rede] Eine Ansprache des stellvertretenden Führers der Reichswehrbrigade 16. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 27. März 1920
Fernschreiben, Blitz. Von SS-Obergruppenführer Heißmeyer Berlin. 1. September 1943. Website: Nazi Tunnel-Archive, http://nazitunnels.org/archive/items/show/146
[Fieker] Vorverfahren in der Strafsache wider Fieker. Blattsammlung der Staatsanwaltschaft beim Landgerichte in Naumburg an der Saale. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft, Hilfsakten. Naumburg Nummer 26 bis 18
Fieker, Walter: An den Untersuchungsrichter hier. Haftentlassungsgesetz. Untersuchungsgefangener Walter Fieker. 23. März 1920. Vorverfahren in der Strafsache wider Fieker. Blattsammlung der Staatsanwaltschaft beim Landgerichte in Naumburg an der Saale. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft, Hilfsakten. Naumburg Nummer 26 bis 18
[Fieker] in der Strafsache gegen Walter Fieker wegen Landfriedensbruch erscheint der Untersuchungshäftling am 9. April 1920 vor dem Untersuchungsrichter Landesgerichtsrat Lohmeyer, um gegen die Anschuldigungen Stellung zu nehmen. Vorverfahren in der Strafsache wider Fieker. Blattsammlung der Staatsanwaltschaft beim Landgerichte in Naumburg an der Saale. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft, Hilfsakten. Naumburg Nummer 26 bis 18
[Fieker] Gefängnisbrief von Walter Fieker vom 25. April 1920. Vorverfahren in der Strafsache wider Fieker. Blattsammlung der Staatsanwaltschaft beim Landgerichte in Naumburg an der Saale. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft, Hilfsakten. Naumburg Nummer 26 bis 18, Blattnummer 46ff.
Fieker, Walter, auf der Großen Protestversammlung gegen das Naumburger Schandurteil über die Märzopfer am 21. Juli 1920. Landeshauptarchiv Sachsen Anhalt, Merseburg, C 141 Naumburg 25-1, Blatt 217-219
Firchau, Hermann: Bericht über die Ereignisse in Bad Kösen am 19. März 1920, unveröffentlicht
Firchau, Hermann: Die politischen Ereignisse der Jahre 1919-1945, unveröffentlicht
Flechtheim, Ossip K.: Die Kommunistische Partei Deutschlands in der Weimarer Republik. Bollwerk-Verlag Karl Drott, Offenbach a. M. 1948
[FLK, 1919] an die Schüler der Untersekunda, Obersekunda, Unterprima und Oberprima. Freiwilliges Landes-Jäger-Korps. Hauptmeldestelle: Berlin-Stegilitz, Albrechtstraße 131. [1919] Originaldokument
[Flugblätter] Der gekappte Kapp. "Lübecker Volksbote. Organ für die Interessen der werktätigen Bevölkerung." Lübeck, den 17. März 1920 [Hier Bericht über den massenhaften Abwurf von Flugblättern durch Kapp-Lüttwitz.]
Forderungen [der Versammlung vom 22. März 1920 in der Reichskrone, Naumburg]. Für die Richtigkeit der Abschrift zeichnet Bürgermeister Roloff am 22. März 1920 gegen. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. C 141 Staatsanwaltschaft Naumburg, Nummer 25-1
Freund, Tapezierer Willi, Naumburg. Zeuge des Staatsanwalts in den Ermittlungen gegen Walter Fieker. Vorverfahren in der Strafsache wider Fieker. Blattsammlung der Staatsanwaltschaft beim Landgerichte in Naumburg an der Saale. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft, Hilfsakten. Naumburg
[Gegenrevolution] Die Vorgänge in Naumburg seit der Gegenrevolution. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 24. März 1920
Gietinger, Klaus: Der Konterrevolutionär. Waldemar Pabst - eine deutsche Karriere. Nautilus, Hamburg 2008
Grzesinski, Albert: im Kampf um die deutsche Republik. Erinnerungen eines Sozialdemokraten. R. Oldenbourg Verlag, München 2001
[Grunert, Otto] Die Demonstrationsversammlung der Sozialdemokratie. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 1. September 1921
Gumbel, E. J.: Vier Jahre politischer Mord. Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin Fichtenau 1922
Hagenberg Rede vom 26. März 1920 in Naumburg. Nach: "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 27. März 1920
Haffner, Sebastian: Die deutsche Revolution 1918/19. Rowohlt Taschenbuchverlag, Reinbek bei Hamburg 2007, 2. Auflage
[Hagenberg Generalmajor] Bekenntnis der Reichswehrbrigade 16 zur Kappregierung. [Weimar, 13. März 1920]. In: Erwin Könnemann, Gerhard Schulze (Herausgeber): Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch. Olzog Verlag, München 2002, Nummer 704, Seite 736
Haltloses Gerücht. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 25. März 1920
Hagenlücke, Heinz: Deutsche Vaterlandspartei. Kommission für die Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien e.V., Bonn. Droste Verlag, Düsseldorf 1997
[Hardt] Verhör von Walter Fieker am 20. März 1920 durch Staatsanwalt Hardt. Vorverfahren in der Strafsache wider Fieker. Blattsammlung der Staatsanwaltschaft beim Landgerichte in Naumburg an der Saale. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft, Hilfsakten. Naumburg, Blatt 6 bis 13
Hardt. Oberstaatsanwalt / Staatsanwaltschaft am Landgericht. Naumburg, den 18. August 1920. Staatsanwaltschaft beim Landgericht Naumburg im Jahre 1920. General-Akten. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg, Rep. C 141 Staatsanwaltschaft, Naumburg 25-1, Blatt 222-225
[Heinrich, Über Leopold] "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 26. August 1921
Heinze, Reichsjustizminister Dr. Rudolf, Verhandlungen des Deutschen Reichstages, Reichstagsprotokolle 1920, 13. Sitzung. Donnerstag, den 29. Juli 1920. http://www.reichstagsprotokolle.de
Heinze, Dr.: Rede in der Sitzung der Nationalversammlung vom 29. März 1920. In: Gustav Stresemann: Die Märzereignisse und die Deutsche Volkspartei. Staatspolitischer Verlag G.m.b.H., Berlin, 1920, Seite 34 bis 49
[Hörsing] Verurteilung des Putsches durch den Oberpräsidenten der Provinz Sachsen. Magdeburg, den 14. März 1920. Aufruf. Seehäuser Wochenblatt, 15. März 1920. Unterzeichnet von Hörsing. In: Erwin Könnemann, Gerhard Schulze (Herausgeber): Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch, Olzog Verlag, München 2002, Nummer 438, Seite 682
[Hörsing] Nr. 28. Der Oberpräsident der Provinz Sachsen Hörsing an die Reichsregierung. Magdeburg, 9. April 1920. R 43 I/2705 [Blatt 131-133, Nachtrag Online-Ed.] [Betrifft: Lage in der Provinz Sachsen und Vollmachten des Oberpräsidenten.] Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik - Das Kabinett Müller I / Band 1 / Dokumente / Nr. 28 Der Oberpräsident der Provinz Sachsen Hörsing an die Reichsregierung. Magdeburg, 9. April 1920, Seite 68-71
[Hörsing] Der Oberpräsident als Reichskommissar, OA.6204.H.. Magdeburg, den 24. April 1920. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg, Staatsanwaltschaft in Naumburg, Generalakten. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft Naumburg, Nummer 25-1, Blatt 1264
Hürten, Hans: Der Kapp-Putsch als Wende. Über Rahmenbedingungen der Weimarer Republik seit dem Frühjahr 1920. Rheinisch-Westfälisch Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 298, Geisteswissenschaften. Westdeutscher Verlag, Opladen 1989
Huth, August: an die Redaktion der Volksstimme (Halle). Bad Kösen, den 17. April 1920. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft Naumburg Nr. 25-1, Blatt 184
Juchasz, Marie, Reichstagsabgeordnete:
Rede. Nationalversammlung, Weimarer am 19. Februar 1919. Reichstagsprotokolle,
1919/20,1. Nationalversammlung, 11. Sitzung. 19. Februar 1919, Seite
177 bis 179.
http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_wv_bsb00000010_00184.html
[Justiz] Die Naumburger Justiz und die Revolution! "Volksbote. Sozialdemokratisches Organ für die Kreise Zeitz, Weissenfels, Naumburg", Zeitz, den 22. April 1920
[Justizminister] Der Justizminister. Zeichen: I. 4929, Berlin den 19. April 1920, Wilhelmstrasse 65. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg, Staatsanwaltschaft in Naumburg, Generalakten. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft Naumburg, Nummer 25-1, Blatt 108
[Jüttner] Bericht an Kapp über die Stimmung der Naumburger Einwohnerwehren und ihre Bereitschaft, den bevorstehenden Staatsstreich zu unterstützen. Naumburg, den 24. Februar 1920. In: Arbeiterklasse siegt über Kapp Lüttwitz. Quellen ausgewählt und bearbeitet von Erwin Könnemann, Brigitte Berthold und Gerhard Schulze. Akademie Verlag, Berlin 1971, Seite 77 bis 78
Jüttner, Max: Aus dem Bericht des Kreisrats für die Einwohnerwehren in den Kreisen Naumburg Stadt und Land und Eckartsberga vom 20. April 1920. Stadtarchiv Naumburg. Sonderakten des Magistrats. Band V: angefangen 1. Januar 1929, geschlossen 1922. Blatt 73 bis 74
[Kabinettsumbildung]
Die Umbildung des Kabinetts. "Deutsche Allgemeine Zeitung, Abendausgabe",
Berlin, den 25. März 1920. Rücktritt des Reichskabinetts. "Deutsche
Allgemeine Zeitung, Abendausgabe", Berlin, den 26. März
1920. Das neue Reichskabinett. "Deutsche Allgemeine Zeitung",
Berlin, den 27. März 1920. Kabinettssitzung vom 29. März 1920,
18 Uhr im Reichstag. Akte der Reichskanzlei Weimarer Republik" online.
http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/01a/mu1/mu11p/kap1_2/kap2_2/index.html
Kampf gegen Spartakus in und um Weißenfels. Mitteldeutsche Nationalzeitung [MDN] - Ausgabe Weißenfels. Halle, den 26. Januar 1935
Kampf um die Republik. "Volksstimme. Sozialdemokratisches Organ für den Regierungsbezirk Magdeburg". Magdeburg, den 21. März 1920, Seite 1
Kampf um die Waffenstreckung in Zeitz. "Leipziger Volkszeitung. Organ für die Interessen des gesamten werktätigen Volkes", Leipzig, den 18. März 1920
Kapps Aufruf vom 13. März 1920. In: Schemann, Ludwig: Wolfgang Kapp und das Märzunternehmen vom Jahre 1920. J. F. Lehmanns Verlag, München, Berlin 1937, Seite 222 bis 224
Kegel [Oberlehrer]. Bericht. Führer der Einwohnerwehrabteilung I T. Naumburg a. S., den 16. April 1920. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. C 141 Naumburg, Nr. 25-2, Blatt 21 ff.
Koenen, Wilhelm: Rede. [Debatte über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses über die Zustände in den Strafanstalten]. In: Verhandlungen des Reichstages. I. Wahlperiode 1920. Band 351. Stenographische Berichte. Druck und Verlag der Norddeutschen Buchdruckerei und Verlagsanstalt. Berlin 1922. Seite 5124 bis 5125. Reichstagsprotokolle 1920/24, 8. 147 Sitzung, Sonnabend, den 19. November 1921. Beginn Seite 5111. http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_w1_bsb00000035_00555.html
Kommando der Schutzpolizei. Naumburg, den 30. Juli 1921. Sonderakten der Polizeiverwaltung Naumburg an der Saale. Stadtverwaltung Naumburg. Massnahmen bei drohenden Unruhen 1919-1921, Stadtarchiv Naumburg (Saale), Signatur 8355
[Kommunisten-Putsch] Der kommunistische Putsch in Bad Kösen. "Naumburger Tageblatt," Naumburg, den 25. März 1925
Könnemann, Erwin: Einwohnerwehren und Zeitfreiwilligenverbände. Ihre Funktion beim Aufbau eines neuen imperialistischen Militärsystems (November 1918 bis 1920), Deutscher Militärverlag, Berlin 1971
Könnemann, Erwin, Hans-Joachim Krusch: Aktionseinheit contra Kapp-Putsch. Der Kapp-Putsch im März 1920 und der Kampf der Arbeiterklasse sowie andere Werktätiger gegen die Errichtung der Militärdiktatur und für demokratische Verhältnisse. Dietz Verlag, Berlin 1972
Könnemann, Erwin, Hans-Joachim Krusch: März 1920. Arbeiterklasse vereitelt den Kapp-Putsch. Dietz Verlag, Berlin 1981
Kormann, Gottfried: Vom heldenhaften Kampf der Arbeiter in Bad Kösen. "Mitteldeutsche Tageszeitung. Freiheit". Organ der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Naumburg (Saale), den 14. Juni 1954
Könnemann, Erwin: Der Marsch auf Berlin. "Neues Deutschland", Berlin, den 13./14. März 2010, Seite 24
Kormann, Gottfried: Vom heldenhaften Kampf der Arbeiter Bad Kösens. Mitteldeutsche Tageszeitung. "Freiheit". Organ der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Naumburg, Sonnabend, den 19. Juni 1954
Kormann, Gottfried: Vom heldenhaften Klassenkampf der Arbeiter Bad Kösens. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung der Stadt. In: Heimatbuch. Herausgegeben vom Rat der Stadt Bad Kösen, Elbe-Saale-Druckerei, Naumburg 1954, Seite 51 ff.
Kormann, Gottfried: Von den Märzaktionen 1920 in Bad Kösen. In: Kulturspiegel, Heft 12, Naumburg 1958, Seite 6 ff.
[KPD-Aufruf] Aufruf der Zentrale der KPD zum Kampf gegen die Militärdiktatur. [Berlin] 13. März 1920 in: Arbeiterklasse siegt über Kapp Lüttwitz. Quellen ausgewählt und bearbeitet von Erwin Könnemann, Brigitte Berthold und Gerhard Schulze, Akademie Verlag, Berlin 1971, Seite 120 bis 123
[KPD] Erklärung der Zentrale der K.P.D. (Spartakusbund). 21. März 1920. In: "Rote Fahne", Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund), Berlin, den 26. März 1920. Seite 2
[Kreisrat] Aus dem Bericht des Kreisrats für die Einwohnerwehren in den Kreisen Naumburg Land und Naumburg Stadt vom 20. April 1920. Stadtarchiv Naumburg Sonderakten des Magistrats Naumburg an der Saale, angefangen 1.1.1920, geschlossen 1922, Archivnummer 9381
[Kreisversammlung] Ausserordentliche Generalversammlung unserer Partei im Naumburg-Weißenfels-Zeitzer Kreise."Volksbote. Sozialdemokratisches Organ für die Kreise Zeitz, Weissenfels, Naumburg", Zeitz, den 14. April 1920
[Krüger] Zivilkommissar für den Regierungsbezirk Merseburg, Krüger. Merseburg, den 24. April 1920. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. C 141 Naumburg, Nr. 25-1, 127
[Kriegsverbrecher ausliefern] Die Festnagelung der wirklichen Kriegsverbrecher. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 13. Februar 1920
Krüger. Zivilkommissar für den Bezirk Merseburg, Tgb. No. IIb/91/20. An die Staatsanwaltschaft Naumburg. Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg, C 141 Naumburg 25-1, Blatt 127
[Krystek-Prozess] Schwurgericht am 3. August 1929. "Naumburger Tageblatt", 4. August 1920
Kumwade, Rittmeister a.D. Helmut, Luisenstraße 18. Zeuge des Staatsanwalts in der Ermittlungen gegen Walter Fieker. Vorverfahren in der Strafsache wider Fieker. Blattsammlung der Staatsanwaltschaft beim Landgerichte in Naumburg an der Saale. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft, Hilfsakten. Naumburg
Kunert, Fritz, Abgeordneter: Rede. Reichstagsprotokolle 1920/24,1. Freitag, den 30. Juli 1920. http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_w1_bsb00000028_00430.html
Legien, Carl: Rede in der Nationalversammlung am 29. März 1920. "Volksstimme", Magdeburg, den 31. März 1920, Seite 2
Lenin, Wladimir I.: [Kapitel] II. Die Kommunisten und die Unabhängigen in Deutschland. In: Der "Linke Radikalismus", die Kinderkrankheit im Kommunismus (1920)
Leopoldt, Adolf: Rote Chronik der Kreise Zeitz, Weißenfels, Naumburg. Herausgeber SPD. Unterbezirk Zeitz-Weißenfels-Naumburg, Zeitz 1931
[Leuna] Kämpfendes Leuna (1916-1945). Die Geschichte des Kampfes der Leuna-Arbeiter. Teil I. 1. Halbband (1916-1933), Verlag Tribüne, Berlin 1961
Liebe, Werner: Die Deutschnationale Volkspartei 1818-1924. Droste Verlag, Düssedorf 1956
Loose, Hans-Dieter: Abwehr und Resonanz des Kapp-Putsches in Hambureg. In: Zeitschrfit des Vereins für Hamburger Geschichte, Jahrgang 56, 1970, Seite 65 bis 96
Ludendorffs neuer Angriff. "Volksstimme". Magdeburg, den 26. Oktober 1919
[Luftschiff] Woher stammt der Name "Luftschiff". In: "Naumburger Heimat". Zwanglos erscheinende Beilage für Ortsgeschichte und Heimatpflege zum "Naumburger Tageblatt" und zur "Bad Kösener Allg. Zeitung." Nummer 18, Naumburg, den 17. Mai 1933
[Maercker 1919] Aus dem Entwurf des Kommandeurs des Freiwilligen Landesjägerkorps, Generalmajor Georg Maercker, vom 31. März 1919 für eine Vorschrift über den Einsatz der imperialistischen Streitkräfte im Inneren. Militärarchiv der DDR R 2880, Blatt 166ff.. In: Dreetz, Dieter, Klaus Gessner, Heinz Sperling: Bewaffnete Kämpfe in Deutschland 1918-1923. Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1988, Seite 318 bis 328
[Maercker] Niederschrift über die Besprechung mit dem Kriegsminister in Weimar am 18.6.1919. Bundesarchiv - Militärarchiv Freiburg i.Br., Nachlaß Poseck N 244/6 a fol. 99-102. Maschinenschrift mit Unterschrift [Abschrift der Ausfertigung]. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, München. Jahrgang 35 (1987) Heft 3, Seite 438 ff.
Maercker, Georg: vom Kaiserheer zur Reichswehr. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Revolution. Verlag K. F. Koehler, Leipzig 1921, speziell auch 336-337
[Mahnmal] Kultiviert und Inschriften wieder lesbar gemacht. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 22. März 2010
Miller, Susanne / Heinrich Potthoff: Kleine Geschichte der SPD. Darstellung und Dokumentation. Verlag Neue Gesellschaft GmbH, Bonn 1983
Mitteilungsblatt No.1, Aktions-Ausschuss Naumburg a.S., 17. März 1920
Mitteilungsblatt No. 2, Aktions-Ausschuss Naumburg a.S., 18. März 1920
Mollenhauer, Ortspolizeibehörde Naumburg] Auftragsgemäß folgendes festgestellt. Naumburg, den 16. Juni 1927. [Aufstellung der Opfer von der Tanne, Bad Kösen, 19. März 1920]
[Mücheln] an den Oberpräsidenten Hörsing. Magdeburg. Schreiben vom Arbeitersekretariat, Deutscher Bergarbeiterverband, Gewerkschaftskartell, Deutscher Metallarbeiterverband und Maschinen- und Heizerverband, Mücheln, den 15. Juni 1920. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Staatsanwaltschaft in Naumburg, Generalakten. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft Naumburg, Nummer 25-1, Blatt 206 f.
Mühleisen, Horst: Annehmen oder ablehnen? Das Kabinett Scheidemann, die Oberste Heeresleitung und der Vertrag von Versailles im Juni 1919 Fünf Dokumente aus dem Nachlass des Hauptmanns Günther von Poseck. In: Vierteljahreszeitschrift für Zeitgeschichte, München, 35 (1987) Heft 3, Seite 417 ff.
Müller, Reichskanzler: Erklärung der Regierung: In: "Volksstimme", Magdeburg, den 31. März 1920
Müller, Senatspräsident, Rede zur Denkmalsweihe für die Gefallenen der ehemaligen Einwohnerwehr und des Landesjägerkorps am 28. April 1935 in Naumburg. In: "Und über Deutschland steht das Morgenrot!". Denkmalsweihe für die Gefallenen der ehemaligen Einwohnerwehr und des Landesjägerkorps, "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 29. April 1935
Nachrichten-Blatt der Reichswehrbrigade XVI., Naumburg a. S., 22. März 1920. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. C 141 Naumburg, Nr. 25-1
[Nationalversammlung] Vorlegung des Reichstagswahlgesetzentwurfs usw. und Auflösung der Nationalversammlung (Nr. 2286 der Drucksachen). Nationalversammlung - 152. Sitzung. Dienstag, den 9. März 1920. In: Verhandlungen des Reichstags. Band 332. Von der 138. Sitzung am 16. Januar 1920 zur 158. Sitzung am 30. März 1920. Druck und Verlag der Norddeutschen Buchdruckerei und Verlags-Anstalt, Berlin 1920, Seite 4793 ff.
Naumburg, 24. März [1920]. "Querfurter Tageblatt", Querfurt, den 24. März 1920
Naumburg. "Volksbote. Sozialdemokratisches Organ für die Kreise Zeitz, Weissenfels, Naumburg", Zeitz, den 13. April 1920
Naumburg. [Bericht über die Ereignisse am 16. März auf dem Markt in Naumburg]. "Volksblatt", Halle, den 13. April 1920
Notizen vom 11. Juni 1920. In: Vorverfahren in der Strafsache wider Fieker. Blattsammlung der Staatsanwaltschaft beim Landgerichte in Naumburg an der Saale. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft, Hilfsakten. Naumburg, Blatt 1 bis 16
[OB] Oberbürgermeister, Der. Naumburg, den 14. April 1920. Sonderakten der Polizeiverwaltung Naumburg a. S., Massnahmen bei drohenden Umsturz. Angefangen 1919. Geschlossen: 1919 (1933). Stadtarchiv Naumburg, Signatur 8355
Oertzen, F.W.: Die deutschen Freikorps. 1818-1923. Brunckmann Verlag, München 3. Auflage, München 1937
Orlow, Dietrich: Preußen und der Kapp-Putsch. In: Vierteljahreszeitschrift für Zeitgeschichte, München, 26 (1978) Heft 2, Seite 191 ff.
Ossietzky, Carl von: Rechenschaft. In: Die Weltbühne. XXVIII Jahrgang, Nummer 19, 10. Mai 1932, Seite 689 bis 709. In: Carl von Ossietzky: Rechenschaft. Publizistik aus den Jahren 1913-1933. Aufbau Verlag, Berlin und Weimar 1970, Seite 262 bis 291
Osterfeld, 22. März. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 24. März 1920
Pforta. 23. März. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 24. März 1920
[Pödelist] Nachrichten von Unstrut und Finne. Freyburg, 23. März. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 24. März 1920
Polizeiverwaltung. Zu berichten an den Regierungspräsidenten in Merseburg. Bericht. 3. Mai 1921. [Klagen über die Tätigkeit von Hauptmann Schmidt.] Stadtarchiv Naumburg (Saale) Sonderakten des Magistrats Naumburg an der Saale. Angefangen 1. Januar 1920. Geschlossen 1922. Signatur 9381
Polizeibericht vom 5. Mai 1920. Sonderakten der Polizeiverwaltung Naumburg an der Saale. Massnahmen bei drohenden Unruhen. Angefangen 1919. Beendet 1921 (1933). Stadtarchiv Naumburg, Signatur 8355
Polizeiverwaltung, Die. 22. April 1920. Unterzeichnet von Roloff [Bürgermeister]. Sonderakten der Polizeiverwaltung Naumburg an der Saale. Massnahmen bei drohenden Unruhen. Angefangen 1919. Beendet 1921 (1933). Stadtarchiv Naumburg, Signatur 8355
Posadowsky-Wehner, Dr. Graf von: Rede zur Vorlegung des Reichstagswahlgesetzentwurfs usw. und Auflösung der Nationalversammlung (Nr. 2286 der Drucksachen). Nationalversammlung - 152. Sitzung. Dienstag, den 9. März 1920. In: Verhandlungen des Reichstags. Band 332. Von der 138. Sitzung am 16. Januar 1920 zur 158. Sitzung am 30. März 1920. Druck und Verlag der Norddeutschen Buchdruckerei und Verlags-Anstalt, Berlin 1920, Seite 4793 ff.
Posadowsky-Wehner, Arthur Graf von: Volk und Regierung im neuen Reich. Richard Schröder Verlag, Berlin 1932
Possögel, Franz (geboren 23. September 1879): Auszug aus einem Brief vom 1. September 1962, Naumburg, unveröffentlicht
Prager, Eugen: Geschichte der USPD. Verlagsgenossenschaft "Freiheit" G.m.b.H., Berlin 1921
Proklamation des Generalstreiks durch die drei Arbeiterparteien im Regierungsbezirk Merseburg. (O.O., vermutlich 13. März 1920] In: Könnemann, Erwin, Gerhard Schulze (Herausgeber): Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch. Olzog Verlag, München 2002, Nummer 434, Seite 680
Pfotenhauer, Otto: Die Niederschlagung des Kapp-Putschs durch die Einheitsaktion der Weimarer Arbeiter. Weimarer Schriften zur Heimatgeschichte und Naturkunde herausgegeben vom Stadtmuseum Weimar. Heft 24, 1973, Kunstdruck Weimar 1973
Protokoll über die Verhandlungen des außerordentlichen Parteitages in Halle. Vom 12. bis 17. Oktober 1920, Verlagsgenossenschaft "Freiheit" e. G.m.b.H., Berlin C2 (ohne Jahresangabe)
[Putschgefahr] Wahlen und Putschgefahr in Deutschland. "Vorarlberger Wacht. Sozialdemokratisches Tagblatt für Vorarlberg". Dornbirn, den 2. Juni 1920
[PV SPD] Aufruf der sozialdemokratischen Mitglieder der Reichsregierung und des Parteivorstandes der SPD zum Generalstreik [Berlin, 13. März 1920] in: Arbeiterklasse siegt über Kapp Lüttwitz. Quellen ausgewählt und bearbeitet von Erwin Könnemann, Brigitte Berthold und Gerhard Schulze, Akademie Verlag, Berlin 1971, Seite 117 bis 118
Reichsheer, Das: 1914 bis 1934. In: Volk und Soldat. Beilage zum "Naumburger Tageblatt" und zur Stadt Kösener Allgemeiner Zeitung 132. 8. Juni 1935, Nummer 132, Seite 1
[Reichsminister für Justiz] nach Deutsche Allgemeiner Zeitung, Der Justizminister über die Verfolgung der Hochverräter, 16. April 1920, Seite 1
[Reichsminister für Justiz] [Fehler im Konspekt erlaubt keine genauere Zuordnung des Telegramms in den Akten. Entschuldigung.] Akten der Staatsanwaltschaft in Naumburg. General-Akten, Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Akten 25-1 bis 25-3, Archiv Dokument 166
Reichswehrbrigade XVI., Naumburg den, 20. April 1920, an I. Staatsanwalt Drygalski [Naumburg]. Akten der Staatsanwaltschaft in Naumburg. General-Akten, Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Akten 25-1
Reichswehr-Zeitfreiwillige. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 24. März 1924
Reichszentrale der Einwohnerwehren "An die Einwohnerwehren Deutschlands!", Berlin den 13. März 1920. In: Arbeiterklasse siegt über Kapp Lüttwitz. Quellen ausgewählt und bearbeitet von Erwin Könnemann, Brigitte Berthold und Gerhard Schulze, Akademie Verlag, Berlin 1971, Seite 125 bis 126
[Reinhold] Bericht von [Paul] Scholz über Karl Reinhold [Naumburg a. S., Neustrasse 57]. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. C 141 Naumburg, Nr. 25-2
[Roloff] Polizeiliche Auskunft. Zu berichten an das Reichsamt des Inneren Berlin. Verfasst von Bürgermeister Roloff am 19. Mai 1919. Stadtarchiv Naumburg Akte Ruhe und Ordnung. Signatur 8356
[Roloff] Polizeiliche Auskunft. 21. Mai 1919. Stadtarchiv Naumburg. Akte Ruhe und Ordnung.1918 bis 1939. Signatur 8356
[Roloff] Zu berichten an den Regierungspräsidenten. 5. September 1919. Stadtarchiv Naumburg, Akte Ruhe und Ordnung. 1918 bis 1939. Signatur 8356
Roloff. Brief an den Regierungspräsidenten von Merseburg, 21. März 1921. Stadtarchiv Naumburg, Sonderakten der Polizeiverwaltung Naumburg. Massnahmen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit. Angefangen 1927. Geschlossen 1937, Archivsignatur 5617
Roloff. Die Polizeiverwaltung. Naumburg, den 22. April 1920. Sonderakten der Polizeiverwaltung Naumburg a. S., Massnahmen bei drohenden Umsturz. Angefangen 1919. Geschlossen: 1919 (1933). Stadtarchiv Naumburg, Signatur 8355
Ruhe in Halle. "Volksstimme", Magdeburg, den 28. März 1920
[Rublacks Äußerung zur Räterepublik] Polizeibericht vom 5. Mai 1920. Sonderakten der Polizeiverwaltung Naumburg an der Saale. Massnahmen bei drohenden Unruhen. Angefangen 1919. Beendet 1921 (1933). Stadtarchiv Naumburg, Signatur 8355
[Schandurteile] Immer neue Schandurteile. "Vorarlberger Wacht. Sozialdemokratisches Tagblatt für Vorarlberg". Dornbirn, den 25. Juli 1920
Die Säuberung der Umgebung. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, 24. März 1920
Scheidemann, Philipp: Den Bestien entschlüpft. In: Das historische Versagen der SPD. Schriften aus dem Exil. Herausgegeben von Frank R. Reitzle. Mit einer Einleitung von Claus-Dieter Crohn. Zu Klampfen! Lüneburg 2002, Seite 27-73
Scheidemann, Philipp: Der Putsch Kapp-Ludendorff [ = Kapitel in: Philipp Scheidemann: Kritik der Deutschen Sozialdemokratie und ihrer Führung]. In: Das historische Versagen der SPD. Schriften aus dem Exil. Herausgegeben von Frank R. Reitzle. Mit einer Einleitung von Claus-Dieter Crohn. Zu Klampfen! Lüneburg 2002, Seite 141-150
Schemann, Ludwig: Wolfgang Kapp und das Märzunternehmen vom Jahre 1920. J. F. Lehmanns Verlag, München, Berlin 1937
Schiele, Georg. Marktfreiheit und Freizügigkeit. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 19. Februar 1920
Schreiber, Dr. Walther: Die Revolution in Halle an der Saale. Meine Tätigkeit als Zivilkommissar. Otto Hendel in Halle Zeitungsverlag & Druckerei (ohne Jahresangabe) [1920]
Schwere Kämpfe in Halle. "Volksstimme", Magdeburg, den 24. März 1920
Schütze [Bericht über die Ereignisse um die Tanne in Bad Kösen am 19. März 1920]. In: März 1920. Der Beitrag der Arbeiterklasse der Kreise Weißenfels, Naumburg, Hohenmölsen und Zeitz bei der Niederschlagung des militaristischen Kapp-Putsches. Herausgegeben von Kreisleitung der SED Weißenfels, Weißenfels 1960, Seite 33f.
[Schutzpolizei] Kurzer Abriß über den Aufbau, die Tätigkeit und die Auflösung der Schutzpolizei. Stadtarchiv Naumburg, geschlossen: 25. Juli 1926
Schwurgericht am 3. August 1920. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 4. August 1920
Schuhmann, Dirk: Politische Gewalt der Weimarer Republik. Kampf um die Strasse und Furcht vor dem Bürgerkrieg. 1918. 1933. Klartext Verlag, Essen 2001
Schunke, Joachim: Die Schlacht um Halle. Gewehre in Arbeiterhand. Die Abwehr des Kapp-Putsches in Halle und Umgebung. Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung, Berlin 1956
Seeckt, General, Reichswehrministerium:
"Fernschreiben an die Reichswehrkommandos". 18. März 1920,
Nr. 989.3.20T.1.A.3. [Annullierung aller Befehle von Kapp und Lüttwitz].
In: Albert Grzesinski: Im Kampf um die deutsche Republik. Erinnerungen
eines Sozialdemokraten. R. Oldenbourg Verlag, München 2001, Seite
144 f.
Seeckt, gezeichnet
von: Reichswehrministerium. Erlass vom 18. März 1920. [Warnung vor
Spartakus …] In: Albert Grzesinski: Im Kampf um die deutsche Republik.
Erinnerungen eines Sozialdemokraten. R. Oldenbourg Verlag, München
2001, Seite 145
Seeckt von einem alten Soldaten. "Die Weltbühne", Berlin, 22. Jahrgang, 1926, Seite 55ff.
Seldte, Franz (Herausgeber): Der Stahlhelm. Erinnerungen und Bilder. Band 2. Stahlhelm-Verlag GmbH, Berlin 1934
[Senat der Stadt Lübeck] An Lübecks Bevölkerung [zum Kapp-Putsch]. "Lübecker Volksbote", Lübeck, den 16. März 1920
[Staatsanwalt] Der Erste Staatsanwalt. Betrifft die Unruhen in Naumburg. Naumburg a. S., den 14. April 1920. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. C 141 Naumburg, Nr. 25-2, Blatt 23ff.
Standesamt Naumburg (Saale), Sterbebucheintragungen, Stadtarchiv Naumburg
Stein-Saaleck, Hans Wilhelm: Burg Saaleck. Geschichte Sage und Dichtung. Edda Verlag zu Rudolstadt, 15. Oktober 1935, Seite 27f.
Strassenkämpfe in Halle. "Volksstimme", Magdeburg, den 13. Mai 1924
[Streik 1] Jahresdurchschnitt der wegen wirtschaftlicher Forderungen Streikenden und Ausgesperrten nach Gewerbegruppen in den Jahrfünften 1899 bis 1903, 1904 bis 1908, 1909 bis 1913, 1914 bis 1918 und 1919: Grundzahlen, vom Hundert aller Streikenden und Ausgesperrten und vom Hundert der gewerblichen Arbeiter jeder Gruppe. In: Streiks und Aussperrungen in den Jahren 1917, 1918 und 1919. Statistik des Deutschen Reiches, Band 290. Statistisches Reichsamt, Verlag des Statistischen Reichsamtes, Berlin 1920, Seite 7
[Streik 2] Textübersicht [Zahl der Streikenden Betrieb 1906 und 1919]. In: Streiks und Aussperrungen in den Jahren 1917, 1918 und 1919. Statistik des Deutschen Reiches, Band 290. Statistisches Reichsamt, Verlag des Statistischen Reichsamtes, Berlin 1920, Seite 4
Stresemann, Gustav: Die Märzrevolution und die Deutsche Volkspartei. (Zuerst erschienen in der Zeitschrift "Deutsche Stimmen" vom 28. März 1920.) In: Gustav Stresemann: Die Märzereignisse und die Deutsche Volkspartei. Staatspolitischer Verlag G.m.b.H., Berlin, 1920, Seite 3 bis 26
Stresemann, Gustav: Rede am 28. März 1920 vor dem geschäftsführenden Ausschuss der Deutschen Volkspartei. In: Gustav Stresemann: Die Märzereignisse und die Deutsche Volkspartei. Staatspolitischer Verlag G.m.b.H., Berlin, 1920, Seite 29 bis 34
Stresemann, Gustav: Der Aufstand Kapp (1920). In: Gustav Stresemann: Reden und Schriften. Politik - Geschichte - Literatur. 1897-1926. Herausgegeben von Hartmuth Becker, Zweite Auflage. 1. Auflage Carl Reissner Verlag, Duncker & Humblot GmbH, Berlin 2008, Seite 198 ff.
Striesow, Jan: Die Deutschnationale Volkspartei und die Völkisch-Radikalen 1918-1922. Band 1. Haag + Herchen Verlag, Frankfurt a.M.1980
Ströbel, Heinrich: Nach dem Putsch. "Die Weltbühne". XVI. Jahrgang, Nummer 12-14, Berlin, den 25. März 1920, Seite 353 bis 356
Tessin, Georg: Deutsche Verbände und Truppen 1918 - 1939, Osnabrück 1974, Seite 101, 87
Thüringen und Provinz Sachsen. Skandalöse Zustände in Naumburg. "Tribüne", Erfurt, den 27. April 1920
Tucholsky - siehe: Wrobel, Ignaz
Uebelhoer, Friedrich, NSDAP-Kreisleiter und Oberbürgermeister der Stadt Naumburg, Rede zur Denkmalsweihe für die Gefallenen der ehemaligen Einwohnerwehr und des Landesjägerkorps am 28. April 1935 in Naumburg. In: "Und über Deutschland steht das Morgenrot!". Denkmalsweihe für die Gefallenen der ehemaligen Einwohnerwehr und des Landesjägerkorps, "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 29. April 1935
Über den Aufbau, die Tätigkeit und die Auflösung der Schutzpolizei Naumburg an der Saale. II: Die erste, vorübergehende Belegung Naumburgs mit Sicherheitspolizei. Geschlossen 25. Juli 1926, Stadtarchiv Naumburg
Unruhen vom 19. März. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 5. August 1920
[USPD] Zusammenfassender Bericht der Bezirksleitung der USPD über die Ereignisse (Halle, 7. April 1920) In: Erwin Könnemann, Gerhard Schulze (Herausgeber): Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch, Olzog Verlag, München 2002, Seite 730 bis 732
USPD-Versammlung am 5. Mai 1920 in Naumburg. Sonderakten der Polizeiverwaltung Naumburg an der Saale. Massnahmen bei drohenden Unruhen. Angefangen 1919. Beendet 1921 (1933). Stadtarchiv Naumburg, Signatur 8355
[Vereinbarung von Halle, auch Abkommen von Halle genannt] Vereinbarung zwischen dem Oberbefehlshaber für die Provinz Sachsen Reichskommissar Hörsing und Vertretern der Behörden, Garnison, Parteien und Gewerkschaften. Abgeschlossen im Rathaus von Halle am 26.März 1920. Nach: Dr. Walther Schreiber: Die Revolution in Halle an der Saale. Meine Tätigkeit als Zivilkommissar. Otto Hendel in Halle Zeitungsverlag & Druckerei (ohne Jahresangabe), [1920], Seite 35 bis 36
Verhaftung [von Otto Hug]. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 25. März 1920
Verhandlungen zwischen dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, dem Deutschen Beamtenbund, der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände, Regierungsvertretern und Abgeordneten der Koalitionsparteien. Das Ende des Streiks. "Vossische Zeitung", Berlin, den 24. März 1920, Seite 2
Vernehmung von Walter Fieker am 20. März 1920 durch Staatsanwalt Hardt. Vorverfahren in der Strafsache wider Fieker. Blattsammlung der Staatsanwaltschaft beim Landgerichte in Naumburg an der Saale. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg. Rep. C 141, Staatsanwaltschaft, Hilfsakten. Naumburg, Blattnummer 6ff.
Verordnungen der Regierung. Stuttgart, den 16. März 1920. In: "Magdeburger Mitteilungen", Magdeburg, den 16. März 1920
[Vertreterkonferenz] Erklärung der Vertreterkonferenz der am Generalstreik beteiligten gewerkschaftlichen Organisationen. "Vossische Zeitung", Berlin, den 24. März 1920, Seite 2
Vierzehn Tage ohne Zeitung. Ein Rückblick auf die Märztage in Halle. "Volksblatt Halle". Nummer 434, Halle den 31. März 1920. Beilage. Zitiert nach Erwin Könnemann, Gerhard Schulze (Herausgeber): Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch. Olzog Verlag, München 2002, Seite 718f.
Voigt, Fritz [zur Naumburger Arbeiterbewegung], handschriftlich, [Naumburg, am] 1. April 1957, unveröffentlicht
Voigt, Arno: Bilder vom Jagow-Prozess. "Die Weltbühne". 18. Jahrgang, 12. Januar 1922, Heft Nummer 2, Seite 31 ff.
[V & R] Posadowsky-Wehner, Arthur Graf: Volk und Regierung im neuen Reich. Aufsätze zur politischen Gegenwart. Mit einem Gedenkwort v. Staatssekretär Dr. A. Grieser, Berlin. Richard Schröder Verlag, Berlin 1932
"Volksstimme". Nummer 86, 13. April 1920. In: Sonderakten des Magistrats Naumburg an der Saale. Band V., Angefangen 1. Januar 1920. Geschlossen: 1922. Stadtarchiv Naumburg (Saale), Blatt 72 bis 73
Waase, Karl: Die Naumburger Jäger im Weltkriege. Magdeburger Jägerbataillon Nr. 4 nebst allen zugehörigen Kriegsformationen. Akademische Buchhandlung R. Max Lippold, Leipziger Verlagsbuchhandlung 1920 [Karl Waase war Offiziers-Stellvertreter und ehemaliger Kompanieführer der Ersatz-Radfahrer-Kompanie]
Wahlen und Putschgefahr. "Voralberger Wacvht. Sozialdemokratisches Tagblatt für Voralberg." Dornbirn, den 2. Juni 1920
Wallbaum, Eugen: Analyse der Stadt Naumburg. Naumburg, ohne Jahresangabe, um 1950, unveröffentlicht
Weber, Stefan: Ein kommunistischer Putsch, Märzaktion 1921 in Mitteldeutschland. Dietz Verlag, Berlin 1991
Westarp, Kuno Graf von: Konservative Politik im Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Bearbeitet von Friedrich Freiherr Hiller von Gaertringen unter Mitwirkung von Karl J. Mayer und Reinhold Weber, Droste Verlag, Düsseldorf 2011
[Widerhall] Der Widerhall der Märzvorgänge in der Stadtverordnetenversammlung. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 22. April 1920
Wiesner, Der militärische Befehlshaber von Naumburg: Befehl. Naumburg, am 19. März 1920. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Merseburg, C 141 Naumburg, Nr. 25-1
Wheeler, Robert F.: Die "21 Bedingungen" und die Spaltung der USPD im Herbst 1920. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Jahrgang 23, 2. Heft, München 1975, Seite 117 bis 154
Winkler, August [Zum Generalstreik und Naumburger Reichswehr.] Schwurgericht am 3. August 1920. "Naumburger Tageblatt", Naumburg, den 4. August 1920
Winkler, Heinrich-August: Weimar 1918-1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie. Beck, München 1997
Winning, August: Heimkehr. Hamburg 1955
Wrobel [Tucholsky],
Ignaz: Kassandren. 22. Januar 1920. Die Weltbühne. XVI. Jahrgang,
Nummer 12-14, Berlin, den, 25. März 1920, Seite 369
[Wsf] März 1920. Der Beitrag der Arbeiterklasse der Kreise Weißenfels, Naumburg, Hohenmölsen und Zeitz bei der Niederschlagung des militaristischen Kapp-Putsches. Weißenfels. Herausgegeben von der Kreisleitung der SED Weißenfels, 1960
Zeitzer Arbeiter schlagen den Kapp-Putsch nieder. Von einem Kollektiv der Abteilung Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, 9. Jahrgang, 1959/60, Heft 2, Seite 205 bis 221
Bilder
Alte Mühle am Wehr in Bad Kösen (2002). Autor: Christian Bier. Die Bildlizenz erlaubt eine Veröffentlichung auf dieser Website. Vielen Dank Herr Bier.
Herrenstrasse 18, Naumburg. Postkarte von Brück & Sohn, Kunstverlag, Meißen (www.brueck-und-sohn.de)
Für die Personenfotos von Fritz Voigt, Bernhard Düwell und Albert Bergholz lässt sich leider kein Fotograf ermitteln.
Alle anderen historischen Bilder sind älter als 70 Jahre. Für sie lässt sich kein Autor auffinden oder nachweisen.
Die Gegenwartsbilder fotografierte Detlef Belau.
Danksagung
Der Autor dankt Frau Susanne Kröner, Leiterin des Stadtarchivs von Naumburg (Saale), für die Unterstützung des Projekts. 9. Mai 2010
Das Stadtarchiv Erfurt stellte freundlicherweise wichtige Dokumente zur Verfügung.




